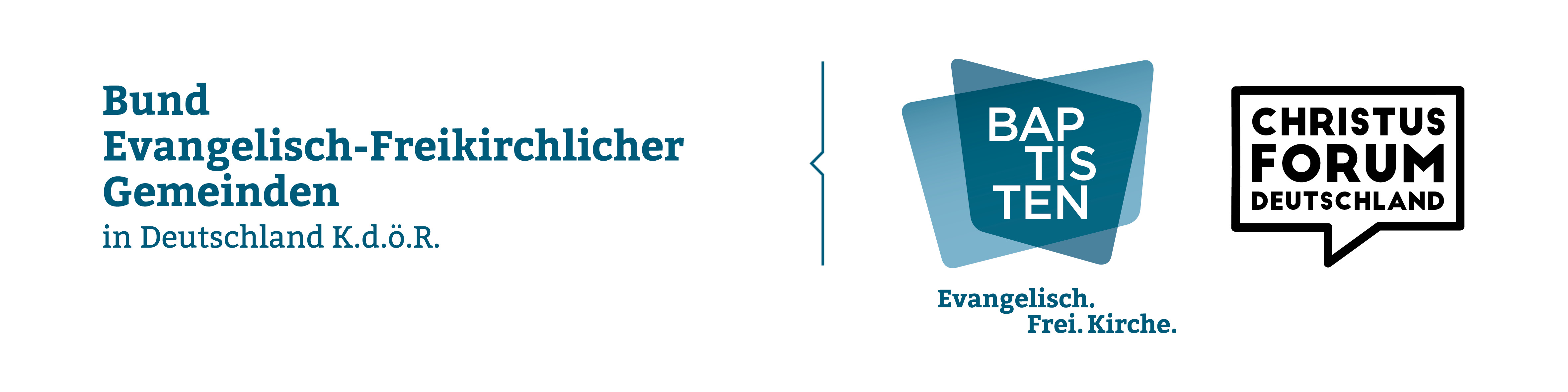Monatsandachten
Geistliche Impulse aus der Theologischen Hochschule Elstal
Die Andachten dürfen kostenfrei in Gemeindebriefen abgedruckt werden. Die Nutzungsbedingungen und alle Dokumente und Bilder zum Download finden Sie auf der Seite der Theologischen Hochschule. Dort können Sie auch bereits jetzt die Andachten für die kommenden Monate herunterladen.
Ältere Andachten finden Sie im Archiv.
Juli 2025
Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! Phil 4,6
Macht euch keine Sorgen! Na, wenn das so einfach wäre.
Warum sollen wir uns eigentlich keine Sorgen machen? Ist es nicht auch gut, wenn wir das tun? Es zeugt doch von Sorgfalt, wenn ich an das denke, was kommen kann und dabei auch daran denke, was alles fehlgehen kann und was im schlimmsten Fall geschehen könnte. Das Miteinbeziehen des „Worst Case“ in meine Planung hilft mir doch das Risiko einzuschätzen, das macht meine Planung doch erst tragfähig. So kann ich doch erst geeignete Vorkehrungen treffen und dem Schlimmsten vorbeugen. Das ist doch richtig, wichtig und gut. Oder?
Mein Sorgen hilft mir eventuell, mich gut vorzubereiten, aber es gibt keine Sicherheit. Möglicherweise treffe ich so die richtigen Entscheidungen, aber es kann auch dazu führen, dass ich mir immer größere Sorgen mache und Angst habe vor dem, was kommt und diese Angst wächst, je mehr ich darüber nachdenke. Sorgen scheinen einerseits ein adäquates Mittel zur gründlichen Planung, aber andererseits lassen sie Ängste wachsen. Sorgen schaffen keine Sicherheit, aber sie bestimmen unsere Blickrichtung: Wir schauen auf das, was schwierig ist und Mühe macht, schief gehen könnte oder auf das, was fehlt.
Philipper 4, 6 lädt uns ein, unsere Blickrichtung zu verändern. Weg von dem, was Mühe macht, weg von den Schwierigkeiten: Auf Jesus hin.
Mit Gebet und Dank richten wir uns auf Jesus aus. Unser Blick ist auf ihn gerichtet. Und das verändert uns. Wir sehen auf Jesus, der selbst dazu auffordert: Sorgt euch um nichts! Wir sehen auf Jesus, der uns Blumen und Vögel als Beispiel für Schönheit und Leichtigkeit vorstellt und uns einlädt, auf Gott zu vertrauen.
Das ist ein schöner Tausch: Vertrauen statt Sorgen – sich Gott anvertrauen statt sich Sorgen zu machen. Dabei werden die Schwierigkeiten nicht ignoriert. Sie werden wahrgenommen und mit Bitten und Flehen ausgedrückt. Der Blick geht weg von den Problemen hin zu Gott, an den sich die Gebete richten. Schwierigkeiten wahrnehmen, als Gebet formulieren, sich auf Gott ausrichten und dann loslassen. Das bringt Frieden.
Und der Friede Gottes, der höher ist als jede Vernunft, als jedes gute und richtige Denken, Sorgen und Planen, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen
Prof. Dr. Andrea Klimt
Rektorin und Professorin für Praktische Theologie
Juni 2025
„Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf.“ (Apg 10,28)
Wir befinden uns mitten in der Apostelgeschichte und dennoch ganz am Anfang der christlichen Kirche. Es ist ein epochaler Wendepunkt in der Missionsgeschichte. Der Protagonist ist Petrus, Apostel, Säule in Jerusalem. Ein Jünger Jesu voll Feuer von Anfang an. Jemand der drauflos geht – manche würden sagen: Mit dem Kopf durch die Wand. Niemand der sich zu viel Sorgen um soziale Konventionen macht. Trotzdem gibt es einen fast unüberwindbaren Graben, der sich der jungen Kirche aufspannt. Bis jetzt haben sie ein klar festgesetztes Missionsziel: Das jüdische Volk. Das ist nur natürlich: Sie selbst bestehen ja auch alle aus Menschen aus dem jüdischen Volk.
Das macht das Leben auch leichter: Der kulturelle Graben zwischen dem jüdischen Volk und den heidnischen Völkern war offensichtlich und spürbar. Speisevorschriften und bestimmte Festtage zogen eine klare Kante zu anderen Völkern, es waren sog. cultural identity marker. Sie ermöglichten keinen leichten Austausch zwischen den Völkern. Jüdische Familien aßen kein Fleisch, das einem anderen Gott geopfert oder geweiht wurde, das machte dann schon das gemeinsame Essen fast zu einem Ding der Unmöglichkeit. Diese Unterschiede sind dabei nicht nur kognitive Lehrdifferenzen, sondern haben mit Lebensweisen und Gewohnheiten zu tun. Diesen Graben zu überspringen, erfordert Mut, Selbstüberwindung. Vermutlich war Schweinefleisch essen für jüdische Menschen mit ähnlichen Emotionen verbunden wie vielen Deutschen das Essen von Hühnerfüßen – die in Asien als Delikatesse gelten.
In Apg 10 begegnet Petrus diesem kulturellen Graben. Gott schenkt ihm eine Vision, wo vom Himmel herab ein Tuch mit Tieren herabkommt, auch mit Tieren, die nach geltendem jüdischem Gesetz klar als unrein gelten. Petrus verweigert das Essen erst, aber Gott entgegnet: „Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen“ (Apg 10,15). Diese Vision fordert Petrus heraus, über die eigenen kulturellen und religiösen Grenzen hinauszublicken. Bei dieser abstrakten Lernerfahrung bleibt es aber nicht: Es klopfen Römer an seine Tür, Petrus soll mit nach Cäsarea ins Haus des Hauptmann Kornelius kommen. Dem intellektuellen Umdenken sollen jetzt auch Taten folgen, die Herausforderung kommt an Petrus' Türschwelle. Allein das Haus eines römischen Hauptmanns zu betreten gilt als unrein und dennoch wagt Petrus diesen Schritt, denn er sagt: „Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf.“ Im Haus des Kornelius predigt Petrus das Evangelium und während er spricht, fällt der Heilige Geist auf alle Anwesenden und Petrus tauft sie.
Diese Geschichte begeistert mich, weil Gott Petrus hilft, seine kulturellen Vorurteile zu überwinden, er nimmt ihn fast mit an die Hand: Er öffnet ihm erst auf kognitiver Ebene durch eine Vision die Augen, dann führt er seine Hand hin zur Begegnung mit dem Haus des römischen Hauptmanns. Im Haus bewegt er Petrus' Herz als er merkt, dass der Heilige Geist auch auf die Heiden fällt. Gott nimmt den ganzen Petrus mit und eröffnet damit der Welt das Evangelium. Wie viele Menschen würden heute nicht die Botschaft von Jesus Christus gehört haben, wenn nicht Petrus Augen, Hand und Herz für Menschen geöffnet hätte, die ihm doch so fremd waren.
Mich ermutigt das auch für heute! Gottes Auftrag an uns lautet, in die Welt zu gehen und das Evangelium zu verkünden – in Wort und Tat. Dafür müssen wir nicht mal weit gehen. Im nächsten Umfeld gibt es Menschen, denen wir die gute Botschaft von Gottes Friedensreich hörbar und erlebbar machen können – ihnen das Evangelium gönnen können (Karl Barth KD I,2,488). Das erfordert aber, dass auch wir kulturelle Fremdheitserfahrungen überwinden können, uns auf neue Menschen und ihre Kulturen einlassen können. Gerade für so eine Offenheit für andere Menschen zugunsten des Evangeliums, will ich offene Augen, Hände, Herz und Mut haben. Möge Gott es schenken.
Carl Heng Thay Buschmann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rektoratsassistent der Theologischen Hochschule Elstal
Mai 2025
„Zu dir rufe ich, Herr; denn Feuer hat das Gras der Steppe gefressen, die Flammen haben alle Bäume auf dem Feld verbrannt. Auch die Tiere auf dem Feld schreien lechzend zu dir; denn die Bäche sind vertrocknet.“ Joel 1,19-20
Es ist eine eigenartige Gebetsgemeinschaft, die der Prophet Joel seinen Hörern hier vor Augen malt. Angesichts einer langen Dürre seufzen und schreien Menschen und Tiere gemeinsam zu Gott. Schon in den Versen davor hat der Prophet die Priester, die Ältesten und alle Bewohner des Landes zu Klage und Fürbitte angesichts dieser Trockenheit aufgerufen. Gemeinsam mit ihren Rindern und Schafen, die angesichts des fehlenden Futters seufzen, sollen auch die Menschen fasten und sich dem Gott Israels zuwenden.
Und nun betet Joel mit lauten Klagerufen zum Herrn und nimmt sich dabei die wilden Tiere der Steppe zum Vorbild, die angesichts ihrer vertrockneten Trinkstellen längst zu Gott schreien. Während die Wildtiere wissen, an wen sie sich wenden müssen, muss der Prophet seine Landsleute erst dazu auffordern, aufzuwachen, die Trauergewänder anzuziehen und den Herrn anzurufen. Obwohl die Weinstöcke und Feigenbäume keine Früchte mehr tragen, das Gras und die Bäume vom Feuer verbrannt sind, scheinen bisher nur die Tiere begriffen zu haben, was die Stunde geschlagen hat.
Würden wir heute die Tierwelt fragen, wie es um unsere Erde steht, wir würden vermutlich ähnliche Klagelaute zu hören bekommen, wie der Prophet Joel. Die vertrocknenden Bäche, die anhaltenden Dürren, vom Feuer verbrannte Bäume, sie werden genau wie andere Extremwetterereignisse auch in den gemäßigteren Breiten häufiger. Und nicht nur die Menschen leiden darunter. Immer mehr Tierarten sterben aus, weil sie ihren ursprünglichen Lebensraum verlieren. Und in endgültig ausgetrockneten Seen und Bächen werden keine Fische mehr schwimmen. Und wo nichts mehr wächst, da verhungern Menschen und Tiere gemeinsam.
Joel ruft seine Mitbürger zu Buße und Gebet auf, weil er voraussieht, dass Gott dann eingreifen wird. Wenn ihm die gesamte Schöpfungsgemeinschaft in den Ohren liegt, muss Gott sich einfach erbarmen. Davon ist Joel so überzeugt, dass er kurz darauf auch wieder bessere Zeiten verheißen kann. Und auch dabei sind wieder die Tiere die ersten, denen diese Heilszusagen gelten:
„Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde; denn die Auen in der Steppe grünen, und die Bäume bringen ihre Früchte, und die Feigenbäume und Weinstöcke tragen reichlich. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch den Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet Regen, Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben.“ (Joel 2,22-24)
Vielleicht sollten auch wir auf das Klagen der Tierwelt hören, wenn wir das Offensichtliche nicht verstehen wollen. Katastrophen, die uns zu Buße und Gebet rufen, gibt es auch in unserer Zeit genug. Aber mit Blick auf Gottes Möglichkeiten ist es auch für uns noch nicht zu spät, im Gebet auf sein Eingreifen und auf bessere Zeiten zu hoffen und unser Leben darauf auszurichten.
Prof. Dr. Ralf Dziewas
Prorektor und Professor für Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie
April 2025
„Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete?“ Lk 24,32 (L)
Genau zwölfmal brennt es im Neuen Testament: Lampen und Lichter brennen (Mt 5,15; Lk 12,35; Joh 5,35), außerdem Unkraut (Mt 13,40) und verdorrte Reben (Joh 15,6). Es brennen Fackeln (Offb 4,5) und Berge (Hebr 12,18; Offb 8,8), ein großer Stern (Offb 8,10), und nicht zuletzt der feurige Pfuhl (Offb 19,20; 21,8) am Ende der Johannesoffenbarung.
Aber nur einmal im Neuen Testament brennen Herzen. Eben hier, an dieser Stelle. Es sind die Herzen der Emmausjünger. Sie waren mit Jesus auf dem Weg, ohne ihn zu erkennen. Dann bricht er zu Tisch das Brot, und als sie das sehen, erkennen sie ihn. Danach verschwindet Jesus vor ihren Augen. „Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?“
Was also hat ihre Herzen in Brand gesetzt? Das Reden mit Jesus, und Jesus, der ihnen die Bibeltexte ausgelegt und erklärt hat: „Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war.“ (Lk 24,27)
Es überrascht mich, dass ausgerechnet hier, und nur hier im Neuen Testament von brennenden Herzen die Rede ist. An anderer Stelle hätte ich eher damit gerechnet. Zum Beispiel an Pfingsten, als den Jüngerinnen und Jüngern „Zungen, zerteilt und wie von Feuer“ (Apg 2,3) erscheinen und sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. Aber: Es ist hier nicht Feuer vom Himmel, das Herzen in Brand setzt, sondern das Gespräch mit dem Herrn und die Begegnung mit der Schrift. Und das, so verstehe ich den Monatsspruch, gilt auch heute. Das Gespräch mit Jesus, dem Auferstandenen, und die Begegnung mit der Heiligen Schrift, das sind auch heute die Kräfte, die aus Herzen brennende Herzen machen.
Dabei ist das Bild vom brennenden Herz ein durch und durch positives. Deutlich wird das durch die beiden anderen Herzen in unmittelbarer textlicher Nachbarschaft: das träge Herz in Vers 25 und das erschrockene Herz in Vers 38. Auch diese Zustände des Herzens gehören zum Weg des Lebens, damals und heute. Doch es gibt Hoffnung und eine gute Nachricht für beide Herzen: Da ist ein Brennen, das träge Herzen in Bewegung bringt und erschrockenen Herzen wohltut. Es ist ein Brennen, das Herzen nicht verbrennt, sondern bewegt und beruhigt zugleich. Schon Mose erlebte das in seinem Gespräch mit Gott; ein Feuer, das brannte, aber nicht verzehrte (2. Mose 3,2-6). Ist es dieses Feuer, das im Gespräch mit Jesus und durch seine Auslegung der Schrift („Er fing an bei Mose …“!) auf die Herzen der beiden Jünger übergreift? Wie dem auch sei: Das Feuer des Gesprächs mit Jesus Christus und der Begegnung mit der Heiligen Schrift kann träge Herzen bewegen und erschrockene Herzen beruhigen – damals und heute. Gott sei Dank.
Pastor Dr. Maximilian Zimmermann
Professor für Systematische Theologie an der Theologischen Hochschule Elstal
März 2025
Und wenn ein Fremder bei dir lebt in eurem Land, sollt ihr ihn nicht bedrängen. 3. Mose 19,33
Die Menschen im alten Israel haben auch erlebt, dass die Begegnung mit Fremdem und Fremden herausfordernd sein kann. Nicht immer führt sie zu offenen Armen. Manchmal löst sie Verteidigungshaltungen oder Abwehrreaktionen aus, gelegentlich sogar Gewalt. Fremde werden bedrängt. So menschlich allzu menschlich ging es wohl schon immer zu, andernfalls wäre dieses Gebot gar nicht in die Bibel aufgenommen worden.
Wurde es aber. Und zwar deshalb, damit wir unsere Skepsis Fremden(m) gegenüber und die mit ihr einhergehenden Reflexe durchbrechen und einen anderen Umgang einüben; ein alternatives Verhaltensmuster ausprobieren. Das könnte so aussehen: Fremdes an sich heranlassen, Fremden Raum schaffen, in die Begegnung gehen, das Miteinander suchen.
Ein Schlüssel dafür ist die Erinnerung an die eigene Erfahrung. Ein Vers weiter wird Israel daran erinnert, dass es selbst mal zu den Fremden gehörte. Sklaven waren sie in Ägypten. Heimatlos, am unteren Ende der gesellschaftlichen Hierarchie.
Manche werden zustimmend nicken, weil sie diese Erfahrung kennen. Für Herkunftsdeutsche wie mich gehören solche Erlebnisse nicht zur Biografie. Aber wir können versuchen, uns in die Situation Fremder hineinzuversetzen.
Als meine Eltern vor einigen Jahren Kontakt zu Geflüchteten aus der Türkei bekamen und ihnen Deutschunterricht gaben, sagte mein Vater irgendwann zu meiner Mutter: Wie wären wir wohl damit umgegangen, wenn wir mit kleinen Kindern in ein anderes Land hätten fliehen und alles zurücklassen müssen? Diese Frage, dieses Mitschwingen mit den Erfahrungen anderer hat Offenheit für „die Fremden“ und Nähe zu ihnen erzeugt. Bei seiner Beerdigung waren viele aus der türkischen Gruppe anwesend und erwiesen ihm als Muslime auf einer christlichen Beerdigung die letzte Ehre. Das war mehr als nur eine Geste. Mich hat das sehr angerührt und mich bestätigt: sich empfänglich für die Erfahrung anderer machen, öffnet Herzen und erzeugt Nähe. Und wer sich einmal auf echte Begegnungen eingelassen hat, wird den Fremden nicht mehr bedrängen.
Das ist noch keine Lösung für die vielen Fragen rund um das Thema Migration, das uns in Deutschland gegenwärtig bewegt. Und ja, man muss nicht alle und alles umarmen. Aber Gott zeigt uns hier einen Weg für einen gerechten Umgang mit den Fremden, die unter uns sind. Wenn wir ihn gehen, werden wir nicht nur Überraschendes erleben, sondern auch ihm selbst begegnen. Denn: „Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen,“ sagt Jesus.
Prof. Dr. Oliver Pilnei
Professor für Praktische Theologie
Februar 2025
Du tust mir kund den Weg zum Leben. Psalm 16,11
Dieser Vers fasst wunderschön das Herz des Wunsches Gottes für sein Volk zusammen: nicht nur Gottes Wunsch uns auf die Wege zu führen, die wir gehen sollen, sondern uns auch in die Fülle von Freude und Erfüllung eintauchen zu lassen, die allein von Gott kommt. Gott bietet uns einen Weg an, der zum Leben führt – ein Leben voller Freude, Frieden und Zweck, das im klaren Gegensatz zur Leere steht, die oft mit bloßem Existieren verbunden ist.
Durch die ganze Bibel hindurch wird uns die Wahl zwischen Leben und Tod präsentiert. In Deuteronomium 30,19-20 ermutigt Mose die Israeliten: „Ich habe dir heute Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Wähle das Leben, damit du und deine Nachkommen leben können und damit du den Herrn, deinen Gott, liebst.“ Diese Einladung, das Leben zu wählen, spiegelt Gottes fortwährendes Angebot von Gnade wider, das uns nicht nur die Möglichkeit gibt, zu existieren, sondern auch in der Beziehung mit ihm zu wachsen und zu gedeihen.
Das Neue Testament unterscheidet zwei Arten von Leben. „Bios“ (βίος) bezieht sich auf unsere physische Existenz, das biologische Leben, das wir alle teilen, während „zoë“ (ζωή) sich auf das geistliche, ewige Leben bezieht und Vitalität, Fülle und das Wesen des Lebens betont, das Jesus verspricht, wenn er in Johannes 10,10 sagt: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben (ζωή) haben und es in Fülle haben.“ Dieses Leben im Überfluss ist nicht nur ein bloßes Existieren; es ist eine transformative Beziehung zu Gott, die sich in seiner Gegenwart entwickelt.
Der Begriff aionioszoë (ἀιώνιος ζωὴ) bezieht sich speziell auf das ewige Leben, das Gläubigen versprochen wird, wie zum Beispiel in Johannes 3,16: „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben (ἀιώνιος ζωὴ) hat.“ In 1. Johannes 5,11 lesen wir: „Gott hat uns ewiges Leben (ἀιώνιος ζωὴ) gegeben, und dieses Leben ist in seinem Sohn.“ Die Versöhnung, die wir durch den Tod Christi erfahren, wie es in Römer 5,10 angedeutet wird, erinnert uns daran, dass wir einst Feinde Gottes waren, aber durch seine Gnade und durch sein Leben (ζωὴ) gerettet werden.
Der Weg, den Gott uns anbietet, ist einer der Fülle, wo wir ermutigt werden, die Fülle von Freude und Sinn zu erfahren (Johannes 10,10). Dies steht im Gegensatz dazu, bloß in einem Überlebensmodus oder einer Routine zu existieren. Anstatt in der Fülle Gottes zu leben, ordnen viele Menschen ihr Leben nach populären Bräuchen, Moden und Geschmäckern. Das führt nicht zu einem Leben im Überfluss, sondern zu einer oberflächlichen, vergänglichen Existenz, die frei von Freiheit, Tiefe, Würde und Authentizität ist.
Psalm 16,11 ist eine kraftvolle Aussage, die den Kern unseres Glaubens und unserer Berufung ausdrückt, Gottes Wort fordert uns dazu auf, sich nicht nur mit der irdischen Existenz zufriedenzugeben, sondern eine tiefere, erfüllendere Beziehung zu Gott zu suchen. In dieser Beziehung finden wir echte Freude, Frieden und Sinn. Ich bete, dass wir in der Gewissheit leben, dass wahres Leben und Freude allein bei Christus zu finden sind, und uns täglich dafür entscheiden, diesen Weg des wahren Lebens zu wählen.
Prof. Dr. Joshua T. Searle
Professor für Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie
Januar 2025
Jesus Christus spricht: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen! Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen! Lk 6,27-28
Wenn heute jemand vage etwas von Jesus gehört hat – dann das. Diese radikale Aufforderung, die Feinde zu lieben. Die andere Wange hinzuhalten. Dafür steht Jesus, dafür sollte das Christentum stehen. Manche halten es deshalb für naiv. Andere loben die Idee, fragen aber kritisch: Wer lebt denn wirklich so? Kann man das überhaupt umsetzen?
Ja, diese Aufforderung ist radikal. Weltfremd ist sie nicht. Sie steht in der sogenannten „Feldrede“ (vgl. Lk 6,17), die viel von dem enthält, was Matthäus in der „Bergpredigt“ berichtet (Mt 5-7). Gleich zu Beginn preist Jesus die Armen und Verfolgten selig und kündigt Unheil für die Reichen an (Lk 6,20-26).
Danach folgen unsere Sätze. Erneut benennt Jesus Gewalterfahrungen: Es gibt Feinde, die hassen, verfluchen, beschimpfen. „Hassen“ umfasst dabei auch Ablehnung und Ausgrenzung. Für „beschimpfen“ steht im griechischen Original ein Wort, das auch erniedrigende Taten umfasst. Es geht um mehr als ein paar Schimpfworte: kränkende Ablehnung, üble Nachrede bis hin zu Mobbing und Missbrauch. Erfahrungen, die bis heute zu viele Menschen machen müssen.
Wie kann man mit so etwas umgehen? Wie kommt man da raus? Jesus stellt den vier Angriffsarten vier Verteidigungsstrategien entgegen: Anfeindung und Ablehnung soll man mit Liebe und guten Taten kontern. „Liebe“ meint dabei kein warmes Gefühl, eher praktische Hilfe und ein gutnachbarschaftliches Miteinander (3. Mose 19,17-18; Lk 10,29-37). Den bösen Worten soll man gute entgegenstellen: Verleumder segnen, für Hetzer beten (vgl. Jer 29,7). Also: Gutes tun im direkten Umgang mit denen, die mich anfeinden – und im Gebet ihre demütigenden Worte ins Positive kehren.
Aber ist das nicht eine Zumutung für die Opfer? Ich denke, zwei Voraussetzungen sind wichtig: Zum einen spitzt Jesus etwas zu, was in Wirklichkeit ein längerer Prozess ist. Im Neuen Testament werden ständig die Psalmen zitiert: Jesus und seine Jünger sind tief in dieser Gebetstradition verwurzelt. Die Verarbeitung von Anfeindungen bekommt dort viel Raum. Wer seine Wut und Verletzung in Worte fassen kann, fühlt sich nicht mehr ganz so ohnmächtig. Der weiß sich gesehen von dem Gott, dem das Unrecht nicht egal ist (vgl. Ps 12,6). Der kann es auch Gott überlassen, den Gewalttätern in den Arm zu fallen. Und wer einen „Rachepsalm“ gebetet hat, kann noch einen Schritt weitergehen und Gott sogar für die Feinde bitten. So einen Weg, der die Wut ernst nimmt und doch den Teufelskreis der Gewalt überwindet, beschreibt Paulus im Römerbrief (Röm 12,19-21).
Die zweite Voraussetzung: Jesus sagt kurz darauf, in so einem Verhalten erweisen wir uns als Gottes wahre Kinder (Vers 35). Gottes Vorrat an Güte, Geduld und Liebe ist so viel reicher als unsere armseligen Versuche. Es ist Gottes Liebe, die alles Unrecht, alle Gewalt überwunden und die Macht des Bösen gebrochen hat: Dafür steht das Kreuz (Joh 3,16). Als seine Kinder stärkt und füllt uns diese Liebe – so sehr, dass sie selbst noch unsere Feinde erreichen kann.
Prof. Dr. Deborah Storek
Professorin für Altes Testament
Jahreslosung 2025
„Prüft aber alles und das Gute behaltet.“ (1. Thessalonicherbrief 5,21)
Wir leben in Zeiten, in denen sich unsere Gesellschaft rasant verändert und immer vielfältiger wird. Und manche begrüßen jede Neuerung, während andere lieber das Althergebrachte verteidigen wollen. Und gleichzeitig steigt die Vielfalt in unserer Gesellschaft und der Streit zwischen den verschiedenen Ansichten wird zum Teil erbittert geführt.
Was uns als Problem der modernen Gesellschaft erscheint, ist eigentlich eine uralte Frage. Wie reagieren wir auf neue Herausforderungen und wachsende Vielfalt? Diese Frage ist so alt, dass sie sogar im ältesten Text des Neuen Testaments thematisiert wird. Dort schreibt der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki zu diesem Thema: „Prüft aber alles, und das Gute behaltet.“
Die von Paulus gegründete Gemeinde in Thessaloniki lebte in einer antiken Hafenstadt, in der Menschen aus allen Ländern der Welt zusammenkamen. Und sie brachten unterschiedlichste Religionen und Kulte, philosophische Überzeugungen und Wertvorstellungen mit und stellten damit die junge christliche Gemeinde vor Ort vor viele Fragen. Wie umgehen mit dieser Vielfalt? Wie offen dürfen wir sein? Welche Glaubensgrundsätze, sind unaufgebbar, welche veränderlich? Und wie sieht eine gute christliche Lebenspraxis aus?
„Prüft aber alles, und das Gute behaltet.“ Eine ziemlich pragmatische Antwort, die Paulus hier anbietet. Aber er weiß, wovon er spricht. Er war als Verteidiger einer strengen jüdischen Gesetzesfrömmigkeit aufgewachsen und hatte zunächst die Anhänger des neu entstehenden christlichen Glaubens verfolgt. Was neu und anders war, als er es gelernt hatte, das konnte nicht gut sein. Aber dann machte er die umstürzende Erfahrung, dass ihm der auferstandene Jesus begegnete. Und nach diesem Damaskuserlebnis wurde er zu einem Missionar des neuen Glaubens und zum Begründer eines Christentums, dass sich nicht mehr an die alten Gesetzesvorschriften des Judentums gebunden sah. Er hatte sich also nicht nur auf etwas für ihn wirklich umstürzend Neues eingelassen, sondern es zu seinem Lebensinhalt gemacht.
Die von Paulus formulierte Jahreslosung für das Jahr 2025 enthält auch für unsere Zeit eine praktische Grundhaltung für neue Herausforderungen: Seid offen für das Neue, denn es könnte gut sein. Aber prüft das Neue daran, ob es sich als gut erweist. Und wenn ja, dann behaltet es bei und nehmt es in Eure Lebens- und Gemeindepraxis auf. Dass dieser Vorgang des Prüfens intensive Diskussionen auslösen kann, ist klar. Aber die sind es wert, geführt zu werden, weil wir nur so auch in einer sich schnell verändernden Gesellschaft immer wieder das Gute aus den vielfältigen neuen Möglichkeiten herausfiltern und in unser Leben integrieren können.
Prof. Dr. Ralf Dziewas
Professor für Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie
Dezember 2024
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! (Jesaja 60,1)
Mit großer Wucht ertönt das Wort des Propheten Jesaja: „Mache dich auf, werde licht.“ Dieses Wort hörten zunächst Menschen in Jerusalem lange vor unserer Zeit. Vor vielen Jahren waren dort unter dem Ansturm feindlicher Truppen die Lichter ausgegangen. Nun kehrten die Nachfahren der einstigen Bewohner aus dem Exil in Babylon zurück und das heimatliche Jerusalem sollte wieder hell leuchten. Doch: Wo viel Licht ist, da ist bekanntlich auch viel Schatten. Das verschweigen die folgenden Verse nicht (V. 2a): „Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker.“ Licht und Finsternis stehen sich schroff gegenüber. Mitten in diese finstere Situation der Welt bricht das helle Wort des Propheten für Jerusalem hinein. Im Rückblick in die Vergangenheit mag man sich an den Beginn der Schöpfung erinnern, als Gott mitten in die Finsternis sein schöpferisches Wort gerufen hatte (1Mose 1,3): „Es werde Licht“! und damit den ersten aller Tage beginnen ließ. Im Ausblick in die Zukunft richtet der Prophet die Hoffnung auf die aufgehende Herrlichkeit Gottes, die hell strahlen und Frieden, Gerechtigkeit und ein Ende allen Leides bringen wird (Jes 60, 17.20).
Der Prophet nimmt uns mit hinein in eine Welt zwischen aufgehendem Licht und noch sehr realer Finsternis einer vom Krieg zerstörten Stadt. Er spricht die Hoffnung aus, dass Gott mit seinem heilenden Licht in die finstere Gewalt und die dunklen Nöte von Angst, Not, Hunger, Krankheit, Leid, Gefahr und Tod kommen und diese ein für alle Mal beseitigen wird. „Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt.“ Mit diesen Worten hat Jochen Klepper diese licht- und heilschaffende Bewegung Gottes zum Ausdruck gebracht. Im Advent strecken wir uns nach dem Licht und dem Heil Gottes für uns und diese Welt aus und zünden Lichter der Hoffnung an. Am Christfest feiern wir, dass mitten in der Finsternis von Bethlehem Gott in seinem Sohn Jesus Christus zur Welt gekommen ist, der von sich selbst sagt (Joh 8,12): „Ich bin das Licht der Welt.“ Damit ist das Licht der Herrlichkeit Gottes noch einmal ganz neu und stärker als jemals zuvor in dieser Welt aufgegangen. Denen, die ihm nachfolgen, spricht Jesus zu (Mt 5,14): „Ihr seid das Licht der Welt“. Dieses Licht feiern wir, wenn wir festliche Kerzen anzünden und alte und neue Hoffnungslieder singen: „Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte … vertreib durch deine Macht unsre Nacht“ oder „In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren ... Endlich ist die Dunkelheit bezwungen. Gottes Licht ist zu uns durchgedrungen.“ So können auch wir Gottes Licht unter uns leuchten und klingen lassen.
Dr. Carsten Claußen
Professor für Neues Testament an der Theologischen Hochschule Elstal
November 2024
Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. (Klgl 3,22-23)
Das Kapitel aus den Klageliedern, aus dem dieser Vers stammt, beginnt mit einer eindrücklichen Aufzählung all der Leiden, die der Beter in seinem Leben erleben muss. Er klagt seinen Gott dafür an, dass er in dunklen Zeiten lebt, dass seine Knochen schmerzen und dass seine Haut alt und schlaff geworden ist. Er fühlt sich fast schon wie tot und in seiner ausweglosen Situation alleingelassen und gefangen. Allenfalls Spott hat er noch zu erwarten, so schlecht geht es ihm.
Und noch schlimmer: Auch Gott verschließt seine Ohren vor der Klage des Beters. Er lässt ihn in die Irre laufen, überfällt und zerfleischt ihn wie ein Löwe und schießt dem Beter mit gespanntem Bogen zusätzlich Pfeile in die Nieren, statt ihm zu helfen. Es bleibt ihm nichts Anderes übrig, als auf seinen Problemen herumzukauen wie auf Kieselsteinen und sie mit bitterem Wermut herunterzuspülen.
Aber dann formuliert der verzweifelte Beter plötzlich mit dem Monatsspruch Worte, die an das gemeinsame Bekenntnis Israels erinnern, dass sein Gott gnädig und barmherzig ist, geduldig und von großer Treue. Dieses Bekenntnis wendet der Klagende hier ganz persönlich auf sich selbst an. Wenn all das Üble von Gott kommt, dann muss es auch eine Gabe Gottes sein, dass er in einer Welt, in der die meisten früh sterben, überhaupt alt werden durfte. Und gilt das dann nicht für jeden weiteren Tag? Solange Gott ihn aufwachen lässt, solange ist Gottes Barmherzigkeit offenbar noch nicht ganz ans Ende gekommen. Und solange der Beter einen neuen Morgen erblickt, solange ist die Treue seines Gottes noch immer groß.
Es ist dieser radikale Blickwechsel, der wieder Mut und Hoffnung aufkommen lässt. Schon die Tatsache, überhaupt noch zu leben, kann er nun als Zeichen der Güte Gottes sehen. Und aus dieser Erkenntnis leitet er dann auch die Hoffnung ab, die er direkt danach formuliert: „Der HERR ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der HERR ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des HERRN zu hoffen.“ (Klgl 3,24-27)
Das ist eine Hoffnung gegen die aktuelle Erfahrung des Leidens. Eine Hoffnung, die an Gottes Barmherzigkeit festhält, obwohl noch kein Ausweg in Sicht ist. Ein Blick auf Gottes Güte, um Kraft zu schöpfen für den kommenden Morgen, den nächsten Tag in dunkler Zeit. Eine trotzige Hoffnung, die mit Verweis auf Gottes Treue einfach nicht aufgeben will, weiter mit Gottes Hilfe zu rechnen.
Prof. Dr. Ralf Dziewas
Prorektor und Professor für Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie
Oktober 2024
Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. (Klgl 3,22-23)
Das Kapitel aus den Klageliedern, aus dem dieser Vers stammt, beginnt mit einer eindrücklichen Aufzählung all der Leiden, die der Beter in seinem Leben erleben muss. Er klagt seinen Gott dafür an, dass er in dunklen Zeiten lebt, dass seine Knochen schmerzen und dass seine Haut alt und schlaff geworden ist. Er fühlt sich fast schon wie tot und in seiner ausweglosen Situation alleingelassen und gefangen. Allenfalls Spott hat er noch zu erwarten, so schlecht geht es ihm.
Und noch schlimmer: Auch Gott verschließt seine Ohren vor der Klage des Beters. Er lässt ihn in die Irre laufen, überfällt und zerfleischt ihn wie ein Löwe und schießt dem Beter mit gespanntem Bogen zusätzlich Pfeile in die Nieren, statt ihm zu helfen. Es bleibt ihm nichts Anderes übrig, als auf seinen Problemen herumzukauen wie auf Kieselsteinen und sie mit bitterem Wermut herunterzuspülen.
Aber dann formuliert der verzweifelte Beter plötzlich mit dem Monatsspruch Worte, die an das gemeinsame Bekenntnis Israels erinnern, dass sein Gott gnädig und barmherzig ist, geduldig und von großer Treue. Dieses Bekenntnis wendet der Klagende hier ganz persönlich auf sich selbst an. Wenn all das Üble von Gott kommt, dann muss es auch eine Gabe Gottes sein, dass er in einer Welt, in der die meisten früh sterben, überhaupt alt werden durfte. Und gilt das dann nicht für jeden weiteren Tag? Solange Gott ihn aufwachen lässt, solange ist Gottes Barmherzigkeit offenbar noch nicht ganz ans Ende gekommen. Und solange der Beter einen neuen Morgen erblickt, solange ist die Treue seines Gottes noch immer groß.
Es ist dieser radikale Blickwechsel, der wieder Mut und Hoffnung aufkommen lässt. Schon die Tatsache, überhaupt noch zu leben, kann er nun als Zeichen der Güte Gottes sehen. Und aus dieser Erkenntnis leitet er dann auch die Hoffnung ab, die er direkt danach formuliert: „Der HERR ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der HERR ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des HERRN zu hoffen.“ (Klgl 3,24-27)
Das ist eine Hoffnung gegen die aktuelle Erfahrung des Leidens. Eine Hoffnung, die an Gottes Barmherzigkeit festhält, obwohl noch kein Ausweg in Sicht ist. Ein Blick auf Gottes Güte, um Kraft zu schöpfen für den kommenden Morgen, den nächsten Tag in dunkler Zeit. Eine trotzige Hoffnung, die mit Verweis auf Gottes Treue einfach nicht aufgeben will, weiter mit Gottes Hilfe zu rechnen.
Prof. Dr. Ralf Dziewas
Prorektor und Professor für Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie
September 2024
Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Jeremia 23,23
Hier spricht Gott selbst. Er ist wütend, aufgebracht. Er wendet sich an Propheten, die sein Volk in die Irre führen. Sie reden ihre eigenen Worte und nicht Sein Wort, erzählen von ihren eigenen Träumen und nicht von Träumen, die Er ihnen gab. Sie maßen sich an, in Gottes Namen zu sprechen. Sie lügen und betrügen. Sie wiegen ihre Mitmenschen in einer falschen Sicherheit, reden was gefällt und warnen sie nicht vor den Folgen ihres Handelns. So ist keine Umkehr möglich. Es wird sich nichts verändern. Menschen betrügen andere Menschen zu ihrem eigenen Vorteil und das tun sie im Namen Gottes. Sie Wegweiser, die falsche Wege weisen.
Dieses Verhalten ist Gott nicht verborgen. Er ist nah. Er schaut nicht weg. Er nimmt dies alles wahr. Vor Gott kann sich niemand verstecken und das ist gut so. Gott sagt, dass er auch ein Gott ist, der fern ist. Dies zeigt, dass sich niemand aus der Verantwortung schleichen kann. Die Menschen, die Gott zur Rechenschaft ziehen will, können dem nicht entkommen, z. B. in dem sie sich „in die Ferne“ begeben. Wo immer Menschen vor ihm weglaufen – er ist schon da: Und er spricht die Wegweiser auf ihre Verantwortung an. So geht das nicht! So ist die Liebe nicht! So nicht! Ändert Euch! Dringt durch zur Liebe! Jetzt!
Wo immer Menschen vor Gott weglaufen – ist er schon da: Das ist sehr tröstlich, weil wir immer nur in seine Arme laufen können. An anderer Stelle betet ein Mensch, der diese Erfahrung gemacht hat: Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen: Du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken: Du bist auch da. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt: Selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. (Psalm 139)
Ich ärgere mich, wenn Menschen sich anmaßen, im Namen Gottes zu reden. Es beruhigt mich, dass Gott nah ist und das schlechte Handeln von Menschen wahrnimmt und sie zur Verantwortung ziehen wird. Es tut mir gut, zu wissen, dass er auch in der Ferne ist und
dass sich vor Gott niemand aus der Verantwortung stehlen kann.
Und wenn ich selber nicht weiß, ob ich anmaßend rede, dann kann ich mich dem Beter des Psalms 139 anschließen: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz! Verstehe mich und begreife, was ich denke! Schau doch, ob ich auf einem falschen Weg bin! Und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat!
Der Wegweisung Gottes will ich vertrauen und wenn dann einer kommt und im Namen Gottes spricht, dann prüfe ich das erst einmal ganz genau. Gute Erfahrungen habe ich damit gemacht, zu den angesprochenen Themen erst einmal gründlich Sein Wort zu befragen und das auch gerne in der Gemeinschaft derer, die sich zu Christus bekennen, in dem Gott uns in besonderer Weise nah gekommen ist.
Prof. Dr. Andrea Klimt
Rektorin und Professorin für Praktische Theologie
August 2024
Der Herr heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. Ps 147,3
Diese Bibelworte sind Teil eines Psalms, der ein großes Lob Gottes anstimmt und der zum Singen gedacht war. Dazu ermuntert der erste Vers: „Gut ist es, unserm Gott zu singen; schön ist es ihn zu loben.“ Singen und loben sind die beiden Verben, die anzeigen, dass an ein musikalisch begleitetes Singen der Gemeinde gedacht war. Wie das klang, wissen wir nicht. Vermutlich hat dieser Auftakt Anton Bruckner dazu animiert, dem Psalm eine wunderbare, kantatenähnliche Vertonung zu widmen (Bruckner WAB 37, Psalm 146). Dass sein Werk den Psalm als den 146. ausgibt, liegt daran, dass er sich bei der Zählung an die lateinische Bibel hält. Es lohnt sich, in dieses Werk, das auf Streaming-Plattformen verfügbar ist, einmal hineinzuhören. Dabei fällt auf, dass unser Monatsvers in einem Rezitativ von einem Sopran nur kurz gestreift wird. Die musikalische und stimmliche Wucht konzentriert sich auf V. 5: „Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unbegreiflich ist, wie er regiert.“ Das haben die Verfasser des Psalms offensichtlich erfahren. Und zwar so, dass Gottes Kraft als heilsames und aufrichtendes Handeln erlebt wurde. Die Israeliten, die alles verloren hatten und im Exil in Babylon waren, hat er zurückgeführt. Jerusalem wurde wieder aufgebaut (V.2). Die Herzen, die durch Verlust, Trauer und Hoffnungslosigkeit gebrochen waren, wurden geheilt; schmerzende Wunden angesichts einer erdrückenden Gegenwart wurde von Gott behutsam verbunden.
Manche Gotteserfahrungen kann man nur besingen. Wer singt, nimmt den Mund immer ein bisschen zu voll. Singend sehen wir mehr, als vorfindlich da ist. Der Monatsspruch ist keine Feststellung, die auf alles und jeden zutrifft. Manche werden mit dankbarem Gesichtsausdruck nicken. Andere lecken sich noch ihre Wunden, weil sie eben noch nicht verbunden sind: überflutete Keller, weggespülte Häuser, zerbombte Häuser, viel Verlust, wenig Aufbau.
Als gesungenes Gotteslob ist dieser Vers ein Begleiter für den Sommermonat August. Wir können unsere tiefe Dankbarkeit und unsere ganze Sehnsucht in ihn hineinlegen: „Danke, Herrgott, für deine große Kraft. … Und, ja bitte, lass sie mir, lass sie uns zuteil werden.“
Singend sehen wir nicht nur mehr als vorfindlich da ist, singend sind wir mehr, als wir sind. Manchmal erfahren wir Gottes heilsame Zuwendung gerade singend. Herzen werden heil, Wunden verbunden.
Prof. Dr. Oliver Pilnei
Professor für Praktische Theologie
Juli 2024
„Du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen.“ (Ex 23,2 Elberfelder)
Eine Menge ist mächtig. Nicht erst seit den großen Massenhysterien des Nationalsozialismus ist klar: Eine Masse von Menschen hat eine gewaltige, mitreißende Anziehungskraft. Menschen fühlen sich gerne zugehörig. Einer Masse mit einem vermeintlichen Konsens kann der Einzelne sich nur schwer entziehen. Gerade heute gibt es mit den Sozialen Medien und unserer ausdifferenzierten Gesellschaft immer mehr sogenannte „Bubbles“, Filterblasen, wo wir in Gruppen unterwegs sind, die vor allem unsere eigenen Meinungen widerspiegeln. Das ist aber nur eine neue Episode eines alten Phänomens. Solche Gruppenphänomene haben positive Effekte: Es stärkt das Wir-Gefühl und lässt die Zusammenarbeit leichter fallen. Es gibt eine große Nähe und gute Gemeinschaft.
„Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, die das Böse will.“ (BasisBibel)
In diesen Mengen kann es aber auch dazu kommen, dass sich Meinungen zu Urteilen verhärten, was als böse angesehen wird. Das Erlebnis, dass alle scheinbar dieselbe Meinung haben, senkt dabei die eigene kritische Urteilskraft und Empathie für Menschen außerhalb der Bubble. Deswegen ist es nötig, einen bewussten Umgang mit „der Menge“ zu finden. Es ist heilsam mit Menschen und Meinungen außerhalb der eigenen 'Bubble' ins Gespräch zu kommen und anhand ihrer Perspektiven neu 'das Böse' erkennen zu lernen. Manche 'Bubbles' sind auch zutiefst unbewusst. Als weißer Mann muss ich z.B. Frauen und People of Colour zuhören, um einen Einblick in ihre Lebenswelt zu kriegen. Diese Perspektive bleibt mir sonst verborgen. Gerade der Kontakt mit Menschen, mit denen wir sonst keine Gemeinschaft pflegen, gerade das aktive und reflektierte Zuhören, gibt uns das Handwerkszeug nicht nur der Menge, sondern wirklich dem Guten zu folgen.
„Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen“ (Luther 2017)
Wenn ich in einer Menge stehen bleibe, werde ich mitgerissen. Ich falle zurück in alte Routinen und Denkmuster. Das Fremde bleibt mir fremd. Es erfordert Kraft, Mut, Geduld und Zeit sich aktiv auf andere Menschen und ihre Perspektiven einzulassen und daraus zu lernen. Wenn wir uns passiv verhalten und keine Stellung für das Gute beziehen, dann besteht die Gefahr einfach der Menge zu folgen.
„Steh nicht hinter der Menge, die auf Böses aus ist.“
Ex 23,2 kann uns dazu aufrufen: Verstecke dich nicht hinter der Menge und Mehrheitsmeinung. Laufe nicht einfach mit, lass den Dingen nicht einfach ihren Lauf, sondern gestalte aktiv mit: Setze dich ein für die marginalisierten Gruppen der Gesellschaft, die in der Mehrheitsperpektive nicht vorkommen. Beziehe aktiv Position für das Gute, auch gegen den Strom.
Carl Heng Thay Buschmann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rektoratsassistent an der Theologischen Hochschule Elstal
Juni 2024
Mose sagte: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und schaut zu, wie der HERR euch heute rettet! (Exodus 14,13 (E))
Die Geschichte, wie die Israeliten das Meer durchziehen und den Ägyptern entrinnen, übt bis heute ihren Reiz aus. Befreiung aus Tyrannei und Zwang, auch wenn alles verloren geglaubt wird, scheint eine tiefe Sehnsucht bei vielen Menschen wachzurufen. Die Dokumentarserie „Testament. Die Geschichte von Moses“, welche seit kurzem auf der Streaming-Plattform Netflix zu sehen ist, ist nur eines von vielen Beispielen für diese anhaltende Faszination. Von der Überzeugungskraft dieses Formats mag sich jede und jeder selbst ein Bild machen. Die Bibel jedenfalls legt es nicht darauf an, das Wunder als ein Ereignis darzustellen, das man lediglich als interessierter Zuschauer bestaunt.
Der Appell Moses in 2Mo 14,13 widerspricht dem nur auf den ersten Blick. Streng genommen muss man übersetzen: „Fürchtet euch nicht. Nehmt Aufstellung und seht, wie der HERR euch heute rettet!“. Gemeint ist in diesem Fall kein apathisches Stehenbleiben, sondern ein fokussiertes sich Hinstellen. Im kriegerischen Zusammenhang geht es darum, dass sich die Soldaten für eine Schlacht formieren, sich gegenseitig aufputschen, um die eigene Angst zu überspielen und den Gegner zu beeindrucken (so wie es die Philister in 1Sam 17,16 zelebrieren). Doch der Konflikt im Buch Exodus wird anders ausgefochten: Hier wird niemand angestachelt („Tschakka!“) oder bloß beschwichtigt („Da kannst du eh nichts machen“). Die Israeliten werden vielmehr aufgefordert, sich aufzustellen, bereit zu sein – um dann im entscheidenden Augenblick in das sich vor ihnen öffnende Wasser loszugehen.
Dieses Bild knüpft an die Kindheitsgeschichte Moses an, in der Mirjam – seine Schwester – ihn rettet (2Mo 2,1–10). Mirjam steht und beobachtet genau, wie die ägyptische Prinzessin Mose im Wasser findet. In dem Moment, als sie das Mitleid der Pharaonentochter sieht, kommt sie aus ihrem Versteck und schlägt vor, eine Amme zu rufen – die letztlich niemand anderes ist als die Mutter von Mose. So überlebt Mose, der wiederum später die Israeliten aus Ägypten führt.
Im aufmerksamen Hinschauen und Handeln von Menschen handelt offenbar Gott.
Prof. Dr. Dirk Sager
Professor für Altes Testament
Mai 2024
Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten.
Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. (1. Korinther 6,12)
„Alles ist mir erlaubt!“ Das wäre doch schon ein guter Monatsspruch gewesen, oder? Die christliche Freiheit auf den Punkt gebracht. Zur Unterstützung könnte man weitere Sätze dazustellen, die Paulus geschrieben hat. Der Gemeinde in Galatien ruft er zu: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“ (Galater 5,1).
Freiheit ist ein hoher christlicher Wert. Dass wir an einen Gott glauben, der in die Freiheit führt, zeigt sich schon im Alten Testament: „Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe.“ So stellt sich Gott in 2. Mose 20,2 vor. Aus der Knechtschaft in die Freiheit führt er, in ein gutes Land hinein – das hat Israel erlebt, so haben sie Gott kennen gelernt.
Diese Freiheit sehe ich bei Christen nicht immer. Allzu häufig verheddern wir uns in Regeln oder lassen uns von Ängsten bestimmen. Für mich war es ein wichtiger Prozess, die Freiheit Gottes zu entdecken. Sie war nicht einfach „da“. Aber immer wieder habe ich erlebt, dass Gott mir Freiheit und Raum zur Entfaltung zuspricht. Mich herausführt aus mancher Enge in seinen weiten Raum.
Die doppelte Aussage „Alles ist mir erlaubt“ ist also nicht nur der Auftakt für das „Aber“, das folgt. Auch wenn Paulus hier vielleicht einen Satz zitiert, den die Korinther gerne vor sich hertrugen, lehnt er ihn nicht einfach ab. Er stellt nur etwas daneben.
Wie übrigens auch Gott in 2. Mose 20: Auf die Erinnerung an die Befreiung folgen die zehn Gebote. Es sind Leitlinien für einen klugen Gebrauch der Freiheit. So ähnlich macht das Paulus hier. Nur zitiert er nicht göttliche Gebote, sondern wendet sich an die Vernunft. Es sind zwei einfache Faustregeln, mit denen er die Grenzen der eigenen Freiheit ausmisst: Nicht alles dient zum Guten – nichts soll Macht haben über mich.
Der erste Satz klingt im Griechischen weniger moralisch als in der Lutherübersetzung: Nicht alles ist hilfreich, zuträglich, sagt Paulus schlicht. Und der zweite Aspekt weist auf die Gefahr, wie leicht absolute Freiheit in neue Abhängigkeit führt. Wer keinerlei Einschränkungen bei der Handynutzung kennt, kann bald nicht mehr ohne den Kick der kleinen Ablenkungen. Alkohol und gutes Essen können fröhliche Genussmittel sein, mich aber auch in Abhängigkeit und Unglück stürzen. Paulus bezieht seine Faustregeln im Folgenden auf den Gang zu Prostituierten, der in der Hafenstadt Korinth weit verbreitet war. Denkt darüber nach, was ihr da tut, sagt Paulus. Sex ist mehr als Triebbefriedigung, da entsteht eine tiefere Verbindung. Seid ihr euch bewusst, was eure Taten für Folgen haben?
Ich finde diese schlichten Faustregeln immer noch hilfreich. Sie nehmen mich als handelnde Person ernst, sie weisen darauf, dass mein Tun Gewicht hat. Es ist nicht „eh egal“, was ich mache. Ich will mich nicht in Abhängigkeiten ergeben, oder das heute Übliche einfach mitmachen. Ich will ernstnehmen, was ich tue. Will ich das wirklich? Ist es meinem Leben zuträglich? Natürlich kann man auch auf der anderen Seite herunterfallen – Selbstkontrolle kann eine Sucht sein, Selbstdisziplin zur Selbstverknechtung werden. Wie also bewahre ich die Freiheit, zu der mich Christus befreit hat? Wo brauche ich Hilfe beim Freiwerden, weil ich mich zu tief in Abhängigkeiten verstrickt habe?
Hier spricht Paulus nur von den Folgen für das eigene Leben, den eigenen Körper. Später führt er die „Alles ist mir erlaubt“-Reihe weiter und weist auch auf die Folgen für andere. In 1. Korinther 10,23f. schreibt er: „Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen!“
Das „Aber“ ist kein Rückfall in Enge und Ängstlichkeit. Im Gegenteil: Wer frei ist, mündig, dem wird auch die Verantwortung zugetraut, klug mit dieser Freiheit umzugehen. Die Folgen für sich und andere im Blick zu haben. So kommen wir immer mehr in die „herrliche Freiheit der Kinder Gottes“ (Römer 8,21) hinein.
Prof. Dr. Deborah Storek
Professorin für Altes Testament
April 2024
Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. (1 Petrus 3,15)
Nicht immer ist Schweigen Gold und Reden Silber. In so manchen Situationen in meinem Leben habe ich geschwiegen, obwohl reden vielleicht hilfreicher gewesen wäre und geredet, obwohl schweigen angebrachter gewesen wäre. Nicht jedem will ich Rede und Antwort stehen oder für alles Rechenschaft ablegen müssen. Doch hier werde ich aufgefordert und herausgefordert: Nicht zu schweigen von der Hoffnung, die mich erfüllt. Hier werden wir, als Gemeinde Christi, aufgefordert nicht zu schweigen, von der Hoffnung, die uns erfüllt.
Die Verse aus dem 1. Petrusbrief richten sich als „Mahnung“ an die Männer und Frauen der Gemeinde der damaligen Zeit. Es wird deutlich: Worte haben Macht und es ist besser, seine Zunge zu hüten und Scheltwort nicht mit Scheltwort zu vergelten. Wie die Menschen von damals sind auch wir heute aufgefordert, Gerechtigkeit anzustreben, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen, anstatt auf Böses mit Bösem zu reagieren, wie es in den Versen zuvor beschrieben wird. Wir werden herausgefordert, unsere innere Hoffnung nicht nur im Herzen zu tragen, sondern dieser auch Ausdruck nach außen zu verleihen in unseren Worten und Taten. Wir sind aufgerufen, jedem Rede und Antwort über diese Hoffnung geben zu können. Wir sind aufgefordert, bei diesem Thema nicht zu schweigen. Jedoch nicht auf eine überhebliche und aufdringliche Weise, sondern sanftmütig, ehrfürchtig und ohne Furcht. Vielleicht erleben wir heute nicht unbedingt Drohungen, wenn wir von der Hoffnung, die uns trägt, erzählen. Vielleicht ist es eher Gleichgültigkeit, vielleicht auch ein belustigtes Grinsen. Vielleicht aber auch ernsthaftes Interesse mit vielen, nicht immer einfachen, Fragen.
Der Monatsvers fordert nicht nur heraus, er lädt auch ein zu einer persönlichen Reflexion: Wie steht es um mein Herz und meine Seele? Bin ich erfüllt von dieser Hoffnung, von der hier die Rede ist? Oder bin ich eher gefüllt mit Ängsten und Sorgen oder Neid und Zorn? „Das, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund.“ Der Vers kann auch eine Einladung sein, das eigene Herz zu prüfen, sich wieder mit dieser Hoffnung zu verbinden und neu Raum zu schaffen: Für Gedanken des Friedens, der Liebe und der Gerechtigkeit. Der Vers ermutigt, nach innen zu schauen, um dann nach außen sprach- und handlungsfähig zu werden. Denn wenn wir innerlich von Hoffnung erfüllt und von Liebe ergriffen sind, dann werden das auch unsere Worte und Taten widerspiegeln.
Dana Sophie Jansen
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Rektoratsassistentin
März 2024
Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.
Entsetzen und Furcht sind im Markusevangelium die zentralen Gefühle angesichts der Auferstehungserfahrung. Die drei Frauen, die am Ostermorgen zum Grab kommen, finden dieses offen vor und entdecken statt dem erwarteten Leichnam des gekreuzigten Jesus im Grab einen Jüngling in weißem Gewand sitzen. Und Markus beschreibt ihre unmittelbare Reaktion mit den Worten: „und sie entsetzten sich“ (V.5). Der Schock war den Frauen offenbar derart ins Gesicht geschrieben, dass der Engel direkt auf ihr Erschrecken reagiert: „Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“ (V.6)
Die beiden Marias und Salome sind so geschockt, dass sie kaum mitbekommen, dass ihnen der Engel noch aufträgt, diese gute Botschaft an die anderen Jünger Jesu zu überbringen. Und dass sie nach Galiläa gehen sollen, um dort den Auferstanden zu sehen, das scheinen sie ebenfalls angesichts ihres Erschreckens überhört zu haben. Denn Markus schildert anschließend keine Freude der Frauen, sondern dass sie voll Zittern und Entsetzen von dem Grab fliehen und niemandem etwas davon erzählen, weil sie sich fürchten (V.8).
Mit dieser Feststellung endete ursprünglich das Markusevangelium. Alle folgenden Verse finden sich erst in späteren Handschriften und sind offenbar eine später angefügte Zusammenfassung der in anderen Evangelien überlieferten Ostererzählungen. Die gute Botschaft bleibt am Ende des ursprünglichen Markusevangeliums ungesagt, weil der Schrecken über das Osterereignis zu groß war und mehr Furcht als Freude auslöste.
Wie kann das sein? Wie ist dann die Auferstehungsnachricht zu den Jüngern gelangt, wenn die Frauen sie nicht weitergesagt haben? Genau diese Frage will der Verfasser offenbar seinen Leserinnen und Lesern vorlegen: Was passiert, wenn die Osterbotschaft nicht weitergegeben wird? Dann bleibt es bei Furcht und Schrecken. Dann gibt es statt Hoffnung und Freude nur die ängstliche Flucht angesichts des offenen Grabes.
Dieser überraschende Schluss ist eine didaktische Meisterleistung des Evangelisten. Er macht allen, die sein Evangelium bis zu diesem überraschenden Ende gelesen haben, deutlich, dass nun sie selbst gefordert sind. Die Botschaft von dem, was Gott mit der Auferweckung des Gekreuzigten getan hat, muss doch weitergesagt werden. Nur so kann die gute Nachricht unter die Leute kommen, dass der Tod nicht das Ende ist. Nur so können alle erfahren, dass Gottes Macht sogar größer ist als der Tod.
Mit seinem überraschenden Evangeliumsschluss nimmt Markus seine Leserinnen und Leser gleichsam in die Pflicht. Ab jetzt kommt es auf jeden an, der weiß, was an Ostern passiert ist. Ab jetzt darf niemand mehr schweigen. Die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu muss in die Welt, damit es nicht bei Furcht und Zittern bleibt, sondern Menschen ermutigende Erfahrungen mit dem Gott machen können, der in der Osternacht den Tod überwunden hat. Das ist der bis heute notwendige Auftrag für alle, die aus Überzeugung Ostern feiern.
Prof. Dr. Ralf Dziewas
Prorektor und Professor für Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie
Februar 2024
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. 2. Tim. 3,16
2. Timotheus 3,16 ist ein Vers, den es sich lohnt zu beherzigen, denn er betont die transformative Kraft des Studiums des Wortes Gottes. Paulus verwendet hier den Begriff „theopneustos“, was wörtlich „vom Atem Gottes inspiriert“ bedeutet. Damit weist er darauf hin, dass die Heilige Schrift nicht einfach menschlichen Ursprungs ist, sondern Gott als ihre Quelle hat. Wie es in unserer Rechenschaft vom Glauben heißt: „Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenmund.“
Dieser Vers erinnert uns daran, dass die Bibel ein Geschenk Gottes ist und niemals auf einen akademischen Text oder ein Objekt der wissenschaftlichen oder literarischen Neugier beschränkt werden sollte. Wie Dallas Willard es einmal zum Ausdruck brachte: „Die Bibel ist schließlich Gottes Geschenk an die Welt durch die Kirche, nicht an die Gelehrten. Sie kommt durch das Leben seines Volkes und nährt dieses Leben.“
Um mit Gottes Wort genährt zu werden, müssen wir regelmäßig Zeiten für fokussierte Studie einplanen. Wenn wir bestimmte Verse auswendig lernen, dann durchdringt das Wort Gottes unseren Willen und übt damit seine transformative Kraft auf die Entwicklung unseres Charakters aus. Das Wort Gottes rüstet und formt uns, selbst wenn wir uns dessen vielleicht nicht bewusst sind. Wenn uns Probleme begegnen, die sich im Laufe unseres Lebens ergeben, bringt uns der Heilige Geist diese lebendigen Worte ins Bewusstsein und hilft uns, in diesen Situationen mit Weisheit und Gnade zu handeln.
Die Heilige Schrift schult unser Herz und unseren Verstand, die Dinge aus der Perspektive der Ewigkeit zu sehen. Durch die Erleuchtung durch das Wort Gottes beginnen wir, das Leben in einem neuen Licht zu betrachten. Anstatt unsere Energie auf nutzlose Bestrebungen zu verschwenden, widmen wir unser Leben der Suche nach Wahrheit.
Wenn wir unseren Verstand in den Dienst der Wahrheit Gottes stellen, indem wir die Schrift engagiert und diszipliniert studieren, kann Gott unseren Verstand als Werkzeug in seiner Hand verwenden, um seinen Rettungsplan in der Welt zu verwirklichen. Es gibt keinen höheren Ruf im Leben als diesen: von Gott berufen zu werden, um sein Königreich hier auf Erden zur sichtbaren Realität zu machen. Regelmäßiges und intensives Studium der Heiligen Schrift rüstet uns für diese essenzielle Aufgabe, zu der Gott uns berufen hat, aus.
Warum versuchen Sie nicht in dieser Woche, einen Vers auswendig zu lernen und dann zwei Minuten pro Tag damit zu verbringen, über diese Worte nachzusinnen und darüber zu beten, wie sie sich auf Ihr Leben anwenden lassen? Besonders passend für diesen Zweck sind Psalm 1,1-2, Sprüche 3,5-6, Johannes 16,33 oder natürlich 2. Timotheus 3,16.
Dr. Joshua T. Searle
Professor für Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie
Januar 2024
Junger Wein gehört in neue Schläuche. Mk 2,22 (E)
Ich schätze es sehr, wenn es uns Menschen in Gemeinde und Gesellschaft gelingt, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Denn ich liebe Altes und ich liebe Neues. Gerade die Verbindung aus Altem und Neuem macht für mich ganz häufig die Schönheit des Lebens aus. Wer könnte Neues schätzen, wenn er nicht zugleich um Altvertrautes wüsste? Und wer kann den Kitzel des Neuen und Unbekannten genießen, wenn da nicht zugleich die Ruhe und Vertrautheit des Alt-Bekannten wären? Es kann ein großer Segen sein, Altes und Neues zu verbinden.
Aber manchmal geht das nicht. Es gibt Situationen auf dem Weg des Lebens und des Glaubens, da muss sich das Neue vom Alten trennen, da müssen Bisheriges und Neues unterschiedliche Wege gehen, weil sonst beides verloren geht. Aus einer solchen Situation stammt der Spruch für diesen Monat. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und den Menschen fällt auf: Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasten viel, aber die Jünger Jesu tun das nicht. Warum eigentlich? Jesus erklärt es. Er sagt sinngemäß – und sehr vereinfacht – in den Versen zuvor: Fasten ist ein Weg, Gottes Eingreifen herbeizusehnen. Allerdings: Ich, Jesus, bin Gottes Eingreifen. Für meine Jünger gibt es gerade nichts herbeizusehnen, weil das Ersehnte in mir da ist. Darum ist für sie gerade keine Zeit der Sehnsucht nach dem, was fehlt, sondern eine Freudenzeit über das, was da ist. Für sie ist gerade nicht Fasten, sondern Feiern und Staunen dran! Fasten und Feiern, das passt genauso wenig zusammen wie junger Wein und alte Schläuche. Schläuche, das waren in der Zeit Jesu Aufbewahrungsbehältnisse für Wein, die meist aus Tierhäuten gewonnen wurden. Und es war genauso, wie Jesus sagt: Neuer, gärender Wein gehörte in neue, flexible Schläuche, denn dieser Druck des Gärens konnte alte Schläuche zum Bersten bringen. Und dann waren am Ende beide verloren: der neue Wein und die alten Schläuche.
Und das ist auch eine Wahrheit des Glaubens und des Lebens: dass manches Neue nicht in alte Formen gepackt werden darf, weil sonst beides kaputtgeht. Nehmen wir an, Sie würden ab morgen ein ganz neues Leben auf Wanderschaft beginnen – und Ihr Haus auf diesen Weg mitnehmen! Das würde am Ende beides kaputt machen: die Wanderschaft und das Haus (von Ihrem Rücken ganz zu schweigen). Nein, ein verwurzeltes Leben passt zum Haus, und ein Leben auf Wanderschaft zum Zelt. Und wer beides liebt, vermischt es nicht. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen genau das: Liebe zum Alten und zum Neuen; und den Mut, Neues und Altes nicht zu vermischen, wenn es für beide das Beste ist. Denn: Junger Wein gehört in neue Schläuche.
Prof. Dr. Maximilian Zimmermann
Professor für Systematische Theologie
Jahreslosung 2024
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe! 1. Korinther 16,14
Liebe macht einen Unterschied.
Aus der Ferne schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Er schreibt an eine zerstrittene Gemeinde in einer schwierigen Situation. Er kann selbst nicht vor Ort sein und die Gemeinde direkt begleiten. So kommt seine seelsorgliche Zuwendung als Gemeindegründer und Gemeindeleiter per Brief. Zum Schluss des Briefes fasst er dann die wesentlichen Anweisungen und Empfehlungen zusammen. Hier betont Paulus noch einmal, was ihm besonders wichtig ist: die Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Die Liebe soll die Grundhaltung sein, in der die Gemeindemitglieder in Korinth leben und handeln. Schon vorher hatte Paulus das betont: Nur die Liebe gibt den Handlungen ihren wahren Wert. Die schönsten Worte klingen, wenn sie ohne Liebe gesagt werden, mechanisch und leer. Selbst der größte Glaube, der größte Verzicht und das größte Leiden nützen nichts ohne Liebe. Die Liebe verändert alles: Worte bekommen Inhalt, Glaube bekommt ein Ziel und das eigene Leiden kann den anderen dienen.
Die Liebe soll die Grundhaltung sein, in der wir leben und handeln. Die Quelle dieser Liebe ist aber nicht im Menschen zu finden. Gott selbst ist der Ursprung dieser Liebe, er ist die Liebe selbst. Unsere Liebe spiegelt dann unser Geliebt-Sein wider, unser Von-Gott-Geliebt-Sein. Das Vorbild für diese Liebe ist Christus selbst. Wenn Paulus die Liebe beschreibt, die geduldig und freundlich ist, die sich zurücknimmt und nicht nachträgt, die Gerechtigkeit sucht und sich an Wahrheit freut, dann malt er seiner Gemeinde Christus vor Augen.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Wenn wir alles in Liebe tun, dann verbinden wir uns mit dieser Liebe Gottes, die in Jesus Christus Gestalt gewinnt. An ihm können wir uns in unserem Denken und mit unserem Handeln orientieren, so lieben wie er.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wenn wir lieben, nehmen wir teil an der Weltgestaltung Gottes durch Liebe. Ich brauche mich nur einklinken in die Liebe Gottes. Mich von ihr beschenken lassen und diese Liebe weiter schenken.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Das ist gar nicht so einfach. Unser Lieben ist begrenzt.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Das ist gar nicht so schwer. Gottes Liebe in Christus weitet unsere Grenzen, schenkt uns Liebe, manchmal da, wo wir sie nicht erwarten.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe: Das ist Erinnerung, Korrektur und Motivation und als Jahreslosung ist es das sogar ein ganzes Jahr lang.
Liebe macht den Unterschied!
Prof. Dr. Andrea Klimt
Rektorin und Professorin für Praktische Theologie