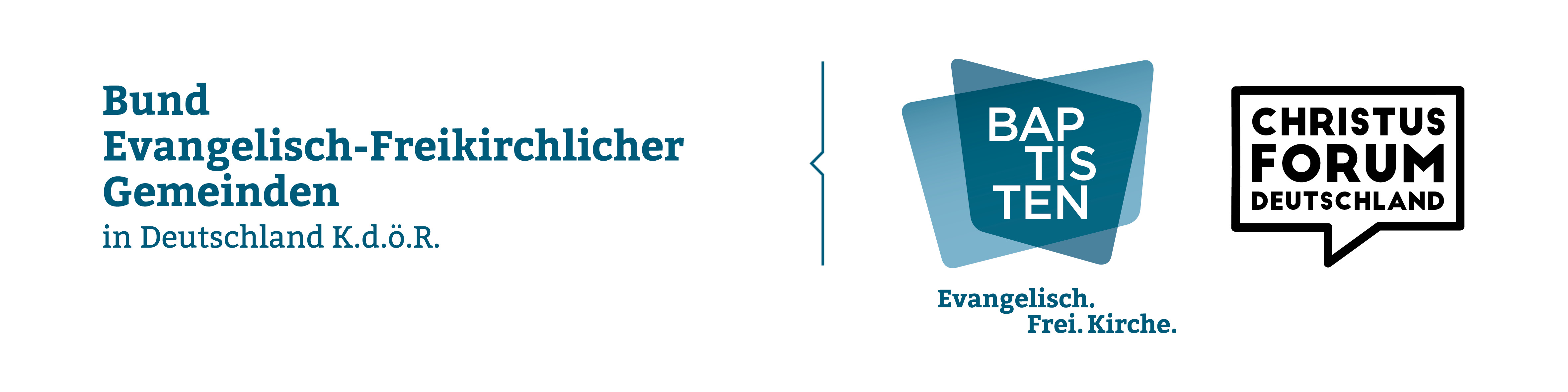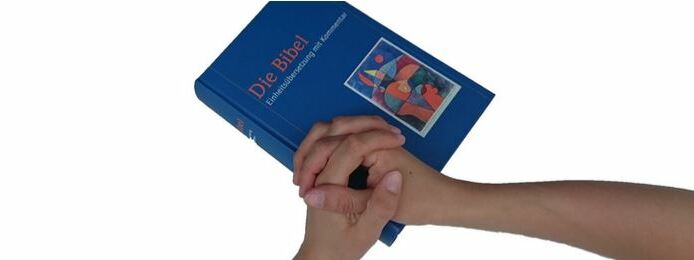
Monatsandachten
Geistliche Impulse aus der Theologischen Hochschule Elstal
Die Andachten dürfen kostenfrei in Gemeindebriefen abgedruckt werden. Die Nutzungsbedingungen und alle Dokumente und Bilder zum Download finden Sie auf der Seite der Theologischen Hochschule. Dort können Sie auch bereits jetzt die Andachten für die kommenden Monate herunterladen.
Ältere Andachten finden Sie im Archiv.
April 2024
Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. (1 Petrus 3,15)
Nicht immer ist Schweigen Gold und Reden Silber. In so manchen Situationen in meinem Leben habe ich geschwiegen, obwohl reden vielleicht hilfreicher gewesen wäre und geredet, obwohl schweigen angebrachter gewesen wäre. Nicht jedem will ich Rede und Antwort stehen oder für alles Rechenschaft ablegen müssen. Doch hier werde ich aufgefordert und herausgefordert: Nicht zu schweigen von der Hoffnung, die mich erfüllt. Hier werden wir, als Gemeinde Christi, aufgefordert nicht zu schweigen, von der Hoffnung, die uns erfüllt.
Die Verse aus dem 1. Petrusbrief richten sich als „Mahnung“ an die Männer und Frauen der Gemeinde der damaligen Zeit. Es wird deutlich: Worte haben Macht und es ist besser, seine Zunge zu hüten und Scheltwort nicht mit Scheltwort zu vergelten. Wie die Menschen von damals sind auch wir heute aufgefordert, Gerechtigkeit anzustreben, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen, anstatt auf Böses mit Bösem zu reagieren, wie es in den Versen zuvor beschrieben wird. Wir werden herausgefordert, unsere innere Hoffnung nicht nur im Herzen zu tragen, sondern dieser auch Ausdruck nach außen zu verleihen in unseren Worten und Taten. Wir sind aufgerufen, jedem Rede und Antwort über diese Hoffnung geben zu können. Wir sind aufgefordert, bei diesem Thema nicht zu schweigen. Jedoch nicht auf eine überhebliche und aufdringliche Weise, sondern sanftmütig, ehrfürchtig und ohne Furcht. Vielleicht erleben wir heute nicht unbedingt Drohungen, wenn wir von der Hoffnung, die uns trägt, erzählen. Vielleicht ist es eher Gleichgültigkeit, vielleicht auch ein belustigtes Grinsen. Vielleicht aber auch ernsthaftes Interesse mit vielen, nicht immer einfachen, Fragen.
Der Monatsvers fordert nicht nur heraus, er lädt auch ein zu einer persönlichen Reflexion: Wie steht es um mein Herz und meine Seele? Bin ich erfüllt von dieser Hoffnung, von der hier die Rede ist? Oder bin ich eher gefüllt mit Ängsten und Sorgen oder Neid und Zorn? „Das, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund.“ Der Vers kann auch eine Einladung sein, das eigene Herz zu prüfen, sich wieder mit dieser Hoffnung zu verbinden und neu Raum zu schaffen: Für Gedanken des Friedens, der Liebe und der Gerechtigkeit. Der Vers ermutigt, nach innen zu schauen, um dann nach außen sprach- und handlungsfähig zu werden. Denn wenn wir innerlich von Hoffnung erfüllt und von Liebe ergriffen sind, dann werden das auch unsere Worte und Taten widerspiegeln.
Dana Sophie Jansen
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Rektoratsassistentin
März 2024
Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.
Entsetzen und Furcht sind im Markusevangelium die zentralen Gefühle angesichts der Auferstehungserfahrung. Die drei Frauen, die am Ostermorgen zum Grab kommen, finden dieses offen vor und entdecken statt dem erwarteten Leichnam des gekreuzigten Jesus im Grab einen Jüngling in weißem Gewand sitzen. Und Markus beschreibt ihre unmittelbare Reaktion mit den Worten: „und sie entsetzten sich“ (V.5). Der Schock war den Frauen offenbar derart ins Gesicht geschrieben, dass der Engel direkt auf ihr Erschrecken reagiert: „Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“ (V.6)
Die beiden Marias und Salome sind so geschockt, dass sie kaum mitbekommen, dass ihnen der Engel noch aufträgt, diese gute Botschaft an die anderen Jünger Jesu zu überbringen. Und dass sie nach Galiläa gehen sollen, um dort den Auferstanden zu sehen, das scheinen sie ebenfalls angesichts ihres Erschreckens überhört zu haben. Denn Markus schildert anschließend keine Freude der Frauen, sondern dass sie voll Zittern und Entsetzen von dem Grab fliehen und niemandem etwas davon erzählen, weil sie sich fürchten (V.8).
Mit dieser Feststellung endete ursprünglich das Markusevangelium. Alle folgenden Verse finden sich erst in späteren Handschriften und sind offenbar eine später angefügte Zusammenfassung der in anderen Evangelien überlieferten Ostererzählungen. Die gute Botschaft bleibt am Ende des ursprünglichen Markusevangeliums ungesagt, weil der Schrecken über das Osterereignis zu groß war und mehr Furcht als Freude auslöste.
Wie kann das sein? Wie ist dann die Auferstehungsnachricht zu den Jüngern gelangt, wenn die Frauen sie nicht weitergesagt haben? Genau diese Frage will der Verfasser offenbar seinen Leserinnen und Lesern vorlegen: Was passiert, wenn die Osterbotschaft nicht weitergegeben wird? Dann bleibt es bei Furcht und Schrecken. Dann gibt es statt Hoffnung und Freude nur die ängstliche Flucht angesichts des offenen Grabes.
Dieser überraschende Schluss ist eine didaktische Meisterleistung des Evangelisten. Er macht allen, die sein Evangelium bis zu diesem überraschenden Ende gelesen haben, deutlich, dass nun sie selbst gefordert sind. Die Botschaft von dem, was Gott mit der Auferweckung des Gekreuzigten getan hat, muss doch weitergesagt werden. Nur so kann die gute Nachricht unter die Leute kommen, dass der Tod nicht das Ende ist. Nur so können alle erfahren, dass Gottes Macht sogar größer ist als der Tod.
Mit seinem überraschenden Evangeliumsschluss nimmt Markus seine Leserinnen und Leser gleichsam in die Pflicht. Ab jetzt kommt es auf jeden an, der weiß, was an Ostern passiert ist. Ab jetzt darf niemand mehr schweigen. Die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu muss in die Welt, damit es nicht bei Furcht und Zittern bleibt, sondern Menschen ermutigende Erfahrungen mit dem Gott machen können, der in der Osternacht den Tod überwunden hat. Das ist der bis heute notwendige Auftrag für alle, die aus Überzeugung Ostern feiern.
Prof. Dr. Ralf Dziewas
Prorektor und Professor für Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie
Februar 2024
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. 2. Tim. 3,16
2. Timotheus 3,16 ist ein Vers, den es sich lohnt zu beherzigen, denn er betont die transformative Kraft des Studiums des Wortes Gottes. Paulus verwendet hier den Begriff „theopneustos“, was wörtlich „vom Atem Gottes inspiriert“ bedeutet. Damit weist er darauf hin, dass die Heilige Schrift nicht einfach menschlichen Ursprungs ist, sondern Gott als ihre Quelle hat. Wie es in unserer Rechenschaft vom Glauben heißt: „Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenmund.“
Dieser Vers erinnert uns daran, dass die Bibel ein Geschenk Gottes ist und niemals auf einen akademischen Text oder ein Objekt der wissenschaftlichen oder literarischen Neugier beschränkt werden sollte. Wie Dallas Willard es einmal zum Ausdruck brachte: „Die Bibel ist schließlich Gottes Geschenk an die Welt durch die Kirche, nicht an die Gelehrten. Sie kommt durch das Leben seines Volkes und nährt dieses Leben.“
Um mit Gottes Wort genährt zu werden, müssen wir regelmäßig Zeiten für fokussierte Studie einplanen. Wenn wir bestimmte Verse auswendig lernen, dann durchdringt das Wort Gottes unseren Willen und übt damit seine transformative Kraft auf die Entwicklung unseres Charakters aus. Das Wort Gottes rüstet und formt uns, selbst wenn wir uns dessen vielleicht nicht bewusst sind. Wenn uns Probleme begegnen, die sich im Laufe unseres Lebens ergeben, bringt uns der Heilige Geist diese lebendigen Worte ins Bewusstsein und hilft uns, in diesen Situationen mit Weisheit und Gnade zu handeln.
Die Heilige Schrift schult unser Herz und unseren Verstand, die Dinge aus der Perspektive der Ewigkeit zu sehen. Durch die Erleuchtung durch das Wort Gottes beginnen wir, das Leben in einem neuen Licht zu betrachten. Anstatt unsere Energie auf nutzlose Bestrebungen zu verschwenden, widmen wir unser Leben der Suche nach Wahrheit.
Wenn wir unseren Verstand in den Dienst der Wahrheit Gottes stellen, indem wir die Schrift engagiert und diszipliniert studieren, kann Gott unseren Verstand als Werkzeug in seiner Hand verwenden, um seinen Rettungsplan in der Welt zu verwirklichen. Es gibt keinen höheren Ruf im Leben als diesen: von Gott berufen zu werden, um sein Königreich hier auf Erden zur sichtbaren Realität zu machen. Regelmäßiges und intensives Studium der Heiligen Schrift rüstet uns für diese essenzielle Aufgabe, zu der Gott uns berufen hat, aus.
Warum versuchen Sie nicht in dieser Woche, einen Vers auswendig zu lernen und dann zwei Minuten pro Tag damit zu verbringen, über diese Worte nachzusinnen und darüber zu beten, wie sie sich auf Ihr Leben anwenden lassen? Besonders passend für diesen Zweck sind Psalm 1,1-2, Sprüche 3,5-6, Johannes 16,33 oder natürlich 2. Timotheus 3,16.
Dr. Joshua T. Searle
Professor für Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie
Januar 2024
Junger Wein gehört in neue Schläuche. Mk 2,22 (E)
Ich schätze es sehr, wenn es uns Menschen in Gemeinde und Gesellschaft gelingt, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Denn ich liebe Altes und ich liebe Neues. Gerade die Verbindung aus Altem und Neuem macht für mich ganz häufig die Schönheit des Lebens aus. Wer könnte Neues schätzen, wenn er nicht zugleich um Altvertrautes wüsste? Und wer kann den Kitzel des Neuen und Unbekannten genießen, wenn da nicht zugleich die Ruhe und Vertrautheit des Alt-Bekannten wären? Es kann ein großer Segen sein, Altes und Neues zu verbinden.
Aber manchmal geht das nicht. Es gibt Situationen auf dem Weg des Lebens und des Glaubens, da muss sich das Neue vom Alten trennen, da müssen Bisheriges und Neues unterschiedliche Wege gehen, weil sonst beides verloren geht. Aus einer solchen Situation stammt der Spruch für diesen Monat. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und den Menschen fällt auf: Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasten viel, aber die Jünger Jesu tun das nicht. Warum eigentlich? Jesus erklärt es. Er sagt sinngemäß – und sehr vereinfacht – in den Versen zuvor: Fasten ist ein Weg, Gottes Eingreifen herbeizusehnen. Allerdings: Ich, Jesus, bin Gottes Eingreifen. Für meine Jünger gibt es gerade nichts herbeizusehnen, weil das Ersehnte in mir da ist. Darum ist für sie gerade keine Zeit der Sehnsucht nach dem, was fehlt, sondern eine Freudenzeit über das, was da ist. Für sie ist gerade nicht Fasten, sondern Feiern und Staunen dran! Fasten und Feiern, das passt genauso wenig zusammen wie junger Wein und alte Schläuche. Schläuche, das waren in der Zeit Jesu Aufbewahrungsbehältnisse für Wein, die meist aus Tierhäuten gewonnen wurden. Und es war genauso, wie Jesus sagt: Neuer, gärender Wein gehörte in neue, flexible Schläuche, denn dieser Druck des Gärens konnte alte Schläuche zum Bersten bringen. Und dann waren am Ende beide verloren: der neue Wein und die alten Schläuche.
Und das ist auch eine Wahrheit des Glaubens und des Lebens: dass manches Neue nicht in alte Formen gepackt werden darf, weil sonst beides kaputtgeht. Nehmen wir an, Sie würden ab morgen ein ganz neues Leben auf Wanderschaft beginnen – und Ihr Haus auf diesen Weg mitnehmen! Das würde am Ende beides kaputt machen: die Wanderschaft und das Haus (von Ihrem Rücken ganz zu schweigen). Nein, ein verwurzeltes Leben passt zum Haus, und ein Leben auf Wanderschaft zum Zelt. Und wer beides liebt, vermischt es nicht. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen genau das: Liebe zum Alten und zum Neuen; und den Mut, Neues und Altes nicht zu vermischen, wenn es für beide das Beste ist. Denn: Junger Wein gehört in neue Schläuche.
Prof. Dr. Maximilian Zimmermann
Professor für Systematische Theologie
Jahreslosung 2024
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe! 1. Korinther 16,14
Liebe macht einen Unterschied.
Aus der Ferne schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Er schreibt an eine zerstrittene Gemeinde in einer schwierigen Situation. Er kann selbst nicht vor Ort sein und die Gemeinde direkt begleiten. So kommt seine seelsorgliche Zuwendung als Gemeindegründer und Gemeindeleiter per Brief. Zum Schluss des Briefes fasst er dann die wesentlichen Anweisungen und Empfehlungen zusammen. Hier betont Paulus noch einmal, was ihm besonders wichtig ist: die Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Die Liebe soll die Grundhaltung sein, in der die Gemeindemitglieder in Korinth leben und handeln. Schon vorher hatte Paulus das betont: Nur die Liebe gibt den Handlungen ihren wahren Wert. Die schönsten Worte klingen, wenn sie ohne Liebe gesagt werden, mechanisch und leer. Selbst der größte Glaube, der größte Verzicht und das größte Leiden nützen nichts ohne Liebe. Die Liebe verändert alles: Worte bekommen Inhalt, Glaube bekommt ein Ziel und das eigene Leiden kann den anderen dienen.
Die Liebe soll die Grundhaltung sein, in der wir leben und handeln. Die Quelle dieser Liebe ist aber nicht im Menschen zu finden. Gott selbst ist der Ursprung dieser Liebe, er ist die Liebe selbst. Unsere Liebe spiegelt dann unser Geliebt-Sein wider, unser Von-Gott-Geliebt-Sein. Das Vorbild für diese Liebe ist Christus selbst. Wenn Paulus die Liebe beschreibt, die geduldig und freundlich ist, die sich zurücknimmt und nicht nachträgt, die Gerechtigkeit sucht und sich an Wahrheit freut, dann malt er seiner Gemeinde Christus vor Augen.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Wenn wir alles in Liebe tun, dann verbinden wir uns mit dieser Liebe Gottes, die in Jesus Christus Gestalt gewinnt. An ihm können wir uns in unserem Denken und mit unserem Handeln orientieren, so lieben wie er.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wenn wir lieben, nehmen wir teil an der Weltgestaltung Gottes durch Liebe. Ich brauche mich nur einklinken in die Liebe Gottes. Mich von ihr beschenken lassen und diese Liebe weiter schenken.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Das ist gar nicht so einfach. Unser Lieben ist begrenzt.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Das ist gar nicht so schwer. Gottes Liebe in Christus weitet unsere Grenzen, schenkt uns Liebe, manchmal da, wo wir sie nicht erwarten.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe: Das ist Erinnerung, Korrektur und Motivation und als Jahreslosung ist es das sogar ein ganzes Jahr lang.
Liebe macht den Unterschied!
Prof. Dr. Andrea Klimt
Rektorin und Professorin für Praktische Theologie
Dezember 2023
Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. (Lk 2,30-31)
Simeon hatte ein Wort von Gott gehört: Er solle nicht sterben, bevor er nicht den Messias, den Christus, gesehen habe. Doch dieses Erlebnis lag nun schon längere Zeit zurück. Simeon wartete und wartete, vielleicht Jahr um Jahr. Manche späteren Nacherzählungen und Bilder stellen ihn als Greis dar. Aber davon weiß der Evangelist Lukas nichts zu berichten. Jedenfalls hatte sich die Sache hingezogen. Simeon gab nicht auf. Er wollte noch etwas vom Leben Gottes in dieser Welt sehen und es umarmen. Endlich: Eines Tages hatte Simeon den Eindruck, er solle in den Tempel gehen. So machte er sich auf den Weg. Der Tempel, das war zu jener Zeit kein Ort der stillen Besinnung und des andächtigen Gebetes, eher ein trubeliger Marktplatz, kein Bethaus, sondern eine „Räuberhöhle“, wie Jesus später sagte (Lk 19,46). Doch wer meint, dass Gott hier fern sei, der irrt. Viele tausend Menschen strömten alljährlich an den großen Pilgerfesten aus der ganzen Mittelmeerwelt nach Jerusalem. Für alle Juden war der Tempel das zentrale Heiligtum und die Wohnstätte Gottes auf Erden. So war es wohl für Simeon nicht ungewöhnlich, genau hier nach dem seit langem erwarteten Gesalbten Gottes, dem Christus des Herrn (V. 26), Ausschau zu halten. Woran mochte er diesen wohl erkennen? Wir wissen es nicht. Die Geschichte fährt ebenso nüchtern wie geheimnisvoll fort (V. 27-31): „Als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern.“ Simeon erweist sich damit als ein Mensch mit einem ganz besonderen Durch- und Einblick. Ein neugeborenes Kind, das von seinen Eltern in den Tempel gebracht wurde, war in Simeons Augen und in den Worten seines Mundes viel, viel mehr als das. Wo andere nur das Kleine und Unscheinbare sahen, da erkannte der prophetische Seher die Größe und das Heil Gottes für alle Welt und alle Völker. Damit wiederholt sich in gewisser Weise das Wunder von Bethlehem. Über dem unscheinbaren Kind in der Krippe hatten schon die Engel gesungen (Lk 2,11): „Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ Wer Gott sucht, der wird ihn in seinem Sohn Jesus Christus finden, damals im Tempel oder in einem Stall – und auch heute mitten in unserem Leben. Dies feiern wir am Christfest.
Prof. Dr. Carsten Claußen
Professor für Neues Testament
November 2023
Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Er macht den Großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens.
(Hiob 9,8-9)
Es ist eine kalte, glasklare Nacht. Ein Mann steht in einer Wüste des Vorderen Orients und blickt in den Himmel. Hiob heißt er. Wie ein aufgespanntes Zelt umgibt ihn der Nachthimmel. Unzählige Sterne leuchten ihm entgegen, und er sieht Sternbilder, die er schon seit Kindertagen kennt. Langsam ziehen sie mit verlässlicher Treue ihre Bahn. Jeden Tag, jedes Jahr. Wie oft schon hat er diese Pracht bestaunt. Bis vor kurzem war der Sternenhimmel für ihn eine Bestätigung der Macht und Überlegenheit Gottes. Diesem Gott war er treu. Und er hatte ihn wiederum mit Glück und Reichtum beschenkt. Aber jetzt, da ihm alles genommen wurde? Besitz, Kinder, Gesundheit. Jetzt leuchten die Sterne immer noch und ziehen gleichmäßig ihre Bahn. Der Himmel aber ist ihm unheimlich geworden. Der Gott, der die Sterne geschaffen und sie auf ihre Bahn geschickt hat, ist ihm fremd.
Gut 2000 Jahre später schaue ich in einer kalten Herbstnacht in denselben Himmel. Ich sehe nicht ganz so viele Sterne, weil die Lichtverschmutzung am Berliner Stadtrand so stark ist. Aber den Großen Wagen finde ich sofort. Und Orion auch. Beim Siebengestirn bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Ich bin fasziniert und könnte stundenlang nach oben blicken. Ich sehe dieselben Sternenbilder wie Hiob. Vor ihm und nach ihm haben sie unzählige Menschen bestaunt. Was hat sich unter ihnen schon alles abgespielt auf dieser Welt? Geschichten des Glücks und der Hoffnung, Schicksale des Elends und der Not. Frieden und Krieg. Und immer ziehen die Sterne ihre Bahn als würde sie das alles nichts angehen.
Für manche Menschen ist eine solche Naturerfahrung wie ein Gottesdienst. Ich kann das gut nachvollziehen, denn die Faszination für den „bestirnten Himmel über mir“ (I. Kant) teile ich. Für mich ist der Sternenhimmel Ausdruck der unendlichen Schöpfermacht Gottes. Ja, die Natur ist ein Buch, in dem wir Gott finden können. Aber was sie uns zeigt, bleibt uneindeutig. Denn der Himmel kann Menschen auch unheimlich werden. Auch das kann ich nachvollziehen. Dass die Natur eine gute Schöpfung Gottes ist, ein Zeichen seiner Treue und Verlässlichkeit, das versteht sich nicht von selbst. Gewiss wird es mir erst, wenn ich in ein anderes Buch schaue – die Bibel. Dort lese ich die unmissverständliche und eindeutige Zusage, dass Gott unwandelbar treu ist; dass er den unendlichen Himmel verlassen hat, um in seinem Sohn Jesus Christus für immer treu an unserer Seite zu sein. Und wenn mir das im Gottesdienst zugesprochen wird und mir Brot und Kelch gereicht werden, dann sehe und schmecke ich die Freundlichkeit Gottes. Mit dieser Erfahrung im Rücken freue ich mich darauf, Gottes Größe und Macht in der nächsten klaren Nacht am Sternenhimmel zu bestaunen.
Prof. Dr. Oliver Pilnei
Professor für Praktische Theologie
Oktober 2023
Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst. (Jakobus 1,22)
Der Schreiber dieses Briefes hat Angst. Er befürchtet, dass seine Leserinnen und Leser sich zu sehr auf ihren Glauben verlassen. Er kennt die Botschaft des Apostels Paulus, dass der Glaube aus der Predigt und damit aus dem Hören auf das Wort Gottes kommt. Aber er findet es ausgesprochen schwierig, wenn daraus abgeleitet wird, dass es nur noch auf den Glauben ankommt.
Was ist mit einem Glauben, der sich nicht im Leben zeigt? Was ist, wenn das Vertrauen auf die Liebe Gottes nicht zu einem veränderten Verhalten führt? Wie sollen andere die Botschaft des Evangeliums als bedeutsam erkennen, wenn sich die Glaubenden in ihrem Verhalten nicht von anderen unterscheiden?
Deshalb kann der Schreiber des Jakobusbriefes geradezu provokativ behaupten, dass der Glaube ohne Werke tot ist (Jak 2,17 und 26). Für ihn gehören Theologie und Ethik, Glauben und Handeln ganz eng zusammen. Nur wenn beides im Leben eines Menschen stimmig ist, entfaltet das Wort des Evangeliums seine Kraft. Nur dann wird der Glaube an Jesus Christus ein überzeugendes Angebot auch für die, die jetzt noch nichts davon wissen.
All dies wurde in einer Zeit geschrieben, als die Christen als neue religiöse Gemeinschaft von ihrer Umwelt kritisch beäugt, zum Teil verleumdet und mitunter sogar verfolgt wurden. Daher war es für die frühe Christenheit eine Selbstverständlichkeit, zunächst einmal ihre guten Taten, ihre Werke der Barmherzigkeit für ihren Glauben sprechen zu lassen. Sie haben Arme gespeist, Kranke versorgt und sich all denen zugewandt, die in schwierigen Lebenssituationen waren. Ihre guten Werke waren eine unverfängliche und authentische Form, den Glauben an Gottes Liebe, Güte und Barmherzigkeit zum Ausdruck zu bringen.
Auch in der modernen, zunehmend nicht mehr von christlichen Traditionen geprägten Gesellschaft, fragen die Menschen danach, wie authentisch der Glaube gelebt wird, von dem jemand redet. Und für wahr hält man nur noch das, was als glaubwürdig erlebt wird. Deshalb sind heute alle Christinnen und Christen herausgefordert, in ihrem praktischen Handeln die Bedeutung des Evangeliums überzeugend vorleben. Und zu einer solchen authentischen Lebensweise ruft der Jakobusbrief auf.
Es war damals nicht anders, als es heute ist. Wer meint, man könne auch ohne gute Werke zum Glauben einladen, der täuscht sich und am Ende auch die, die sich auf den verkündigten Glauben einlassen. Denn die Menschen merken schnell, wenn zwar die Liebe, Güte und Barmherzigkeit gepredigt, am Ende im Gemeindealltag aber Härte, Mitleidlosigkeit und unbarmherzige Ausgrenzung gelebt wird. Und dann wenden sich Menschen ab, egal welche Konfession auf dem Kirchenschild steht.
Überzeugend für den Glauben wirken hingegen Menschen, die ihr Leben und ihre Gemeindearbeit so gestalten, dass beides ihrem Glauben entspricht. Es geht also immer noch darum, nicht nur Hörer der Botschaft von Gottes Liebe Güte und Barmherzigkeit zu sein, sondern die Güte Gottes auch aktiv im eigenen Handeln zum Ausdruck zu bringen. Dann kann aus beidem auch wieder neuer Glaube an das Evangelium erwachsen.
Prof. Dr. Ralf Dziewas
Prorektor und Professor für Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie
September 2023
Jesus Christus spricht: Wer sagt denn ihr, dass ich bin? (Mt 16,15)
Es ist eine natürliche menschliche Neigung: Wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert werden, versuchen wir, das Neue in Kategorien einzuordnen, die uns bequem und vertraut erscheinen. Die religiösen Führer zur Zeit Jesu wollten Jesus nach ihren eigenen Vorstellungen und Erwartungen verstehen. Sie erkannten nicht (und auch wir begreifen dies heute oft nicht), dass es nur möglich ist, die wahre Identität Jesu zu verstehen, wenn wir unsere menschlichen Erwartungen beiseitelegen und uns von Jesu eigener Lehre über sein Leben und seine Mission leiten lassen.
Zu der Zeit, als Jesus predigte, gab es viele religiöse Menschen, die glaubten, dass Gott einen politischen König schicken würde, der eine Armee gegen die römischen Besatzer anführt. In gewisser Weise trafen die Erwartungen des Volkes zu: Jesus wird sein Volk tatsächlich befreien, aber weder durch militärische Eroberung noch politische Macht, sondern durch Leiden, Sterben und schließlich sein Auferstehen zu neuem Leben. Jesus kommt als Befreier, aber er befreit nicht als siegreicher Kriegsheld, sondern als leidender Knecht.
Jesus möchte, dass seine Jünger dies begreifen, und stellt ihnen deshalb eine Frage, deren Antwort er bereits kennt: „Wer sagt denn ihr, dass Ich bin?“ Die Antwort der Jünger verrät uns, wie Jesus von seinen Zeitgenossen wahrgenommen wurde. Die Menschen nahmen an, dass Jesus ein Prophet war, etwas, das sie bereits kannten: vielleicht jemand wie Johannes der Täufer, Elia oder Jeremia. Die Menschen hatten nicht unrecht, aber in Jesus lag eine noch tiefere Identität als die eines Propheten verborgen. Jesus stellt also diese Frage, weil er spürt, dass seine Jünger endlich zu begreifen beginnen, wer er wirklich ist: Jesus war, anders als die früheren Propheten, nicht einfach nur das Sprachrohr Gottes. Er war der verheißene Messias. Anders als der Täufer oder Jeremia hat Jesus nicht einfach nur die Ungerechtigkeit und Korruption böser Herrscher beklagt und verurteilt; vielmehr war er gekommen, um diese bösen Herrscher durch seine Auferstehung als König aller Könige und Herr aller Herren zu überwinden.
Dieser Vers sagt uns, dass die Lehre Jesu seine Jünger zu einer viel umfassenderen Erkenntnis seiner selbst geführt hatte – umfassender als die Erkenntnis, die der Menge zugänglich war. Daraus können wir lernen, dass es nur möglich ist zu wissen, wer Jesus wirklich ist, wenn wir ihm nahe sind. Niemand, der Jesus in einer rein abstrakten, distanzierten akademischen Weise studiert, wird jemals in der Lage sein, eine vollständige Antwort auf die Frage Jesu zu geben: „Wer sagt ihr, dass Ich bin?“ Erst dann, wenn wir Jesus nahe sind und seinen Lehren folgen, können wir wirklich wissen, wer Jesus ist. Keine gewöhnliche menschliche Erkenntnis, kein noch so großes akademisches Studium kann uns zu der Erkenntnis führen, wer Christus wirklich ist. So wie bei den Jüngern ist es auch bei uns: Es bedarf einer Offenbarung von oben, um Jesus, den Sohn des Zimmermanns, als den Sohn des Allerhöchsten zu erkennen. Keiner von uns kann die Frage Jesu beantworten, wenn wir uns nur auf unsere eigene Klugheit oder menschliche Wahrnehmungsfähigkeit verlassen. Nur diejenigen, die Christus eng nachfolgen, können ihn als den Sohn Gottes erkennen.
Versuchen wir also nicht, Jesus durch unser eigenes Verständnis und unsere Erwartungen einzuengen, sondern öffnen wir unsere Herzen, um die Fülle der Offenbarung Gottes zu empfangen.
Prof. Dr. Joshua Searle
Professor für Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie
August 2023
Denn Du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Psalm 63,8 (Luther)
Hat Gott Flügel? Im obigen Psalmengebet wird von den Flügeln Gottes gesprochen. Gott wird hier mit einem Vogel verglichen, der seine Küken schützend unter seine Flügel nimmt. Dieses Bild beschreibt, wie Gott sich als Helfer zeigt: In seiner Nähe dürfen wir uns sicher fühlen, wie die kleinen Vögel unter den Flügeln ihrer Elternvögel.
Was mich so fasziniert, ist die Leichtigkeit und Freude, die sich dabei einstellt. Wenn ein Vogel bedroht wird und Angst hat und sich „unter die Flügel“ begibt, dann stelle ich mir vor, dass das Tier ganz still ist und vorsichtig abwartet, bis die Gefahr vorbeigeht. Das Bild spricht aber davon, dass die Küken hier fröhlich singen. Sie sind völlig ohne Angst. Sie fühlen sich sehr sicher, sodass sie sogar „frohlocken“ können.
Was tun, wenn es schwierig wird? Wenn das Leben oder der Alltag mich überfordert? Wenn sich die ein oder andere Angst einstellt und ich mich unsicher fühle? Wie kann Gott da zu meinem Helfer werden? In der Nähe Gottes kann ich sicher sein. In der Nähe Gottes? Manchmal, gerade in schwierigen Situationen scheint Gott sehr weit entfernt zu sein. Dann fehlt das Gefühl von Schutz und Sicherheit.
Die kleinen Küken suchen die Nähe ihrer großen Elternvögel. Sie laufen ihnen nach. Sie schlüpfen unter ihr Gefieder. Wie kann ich Gottes Nähe suchen, wenn er mir gerade fern erscheint? Ich erinnere mich dann gerne an einen Satz, der mich seit vielen Jahren begleitet: „Gott ist nur ein Gebet weit entfernt“.
Im Gebet kann ich mich an Gott wenden und ihm nahekommen. Hier kann ich meine Ängste und meine Überforderungen ausdrücken. Alles, was mich belastet, kann ich Gott sagen. Hier ist auch Raum für Klage, Zweifel und Verzweiflung, für Ärger, Wut und Hilflosigkeit. Das ist für uns etwas gewöhnungsbedürftig, aber viele Psalmengebete beginnen mit Klagen und Fragen an Gott. In Zeiten, in denen Gott nicht nahe erscheint, nahen sich ihm die Betenden, indem sie Gott fragen, warum er nicht eingreift. Viele dieser Gebete enden dann mit Dank und dem Versprechen, Gottes Wohltaten zu verkündigen. Wir wissen allerdings nicht, wie viel Zeit zwischen Klage und Dank liegt: Stunden, Tage, Wochen, Monate oder mehr?
Im Gebet dürfen wir uns Gott nahen. Er nimmt uns auch mit unseren Ängsten und unserer Hilflosigkeit unter seine Fittiche. Und wenn ich alles, was mich belastet, bei Gott im Gebet abladen kann, dann stellt sich möglicherweise auch eine Leichtigkeit ein. Ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit, ein Vertrauen, dass es gut ist oder wird, auch wenn es sich gerade nicht danach anfühlt und eine Dankbarkeit, dass Gott mein Helfer ist. Möglicherweise endet ein solches Gebet mit Freude.
Von meinem Spaziergang habe ich mir heute eine Feder mitgenommen. Sie soll mich daran erinnern, dass ich sicher und geborgen bin.
Prof. Dr. Andrea Klimt
Rektorin der Theologischen Hochschul Elstal
Juli 2023
Jesus Christus spricht: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet (Matthäus 5,44-45)
Diese kurze Andacht wird nicht die Frage beantworten, wie der Krieg in der Ukraine zu einem Ende kommen und wieder Frieden werden kann. Ich werde dir, liebe Leserin und lieber Leser, auch nicht sagen, was du angesichts von Unfrieden und Gewalt zu tun und zu lassen hast. Und ich werde dich nicht mit lebenspraktischen Beispielen aus deinem Alltag abholen. Heute geht vielmehr darum, dass du ein Wort Jesu in deinen Alltag hineinlässt. Nimm dir zehn Minuten Zeit, nimm eine Bibel zur Hand und lies die Textstellen, von denen hier die Rede ist, lies vielleicht auch ein paar Verse davor und danach.
Wir nähern uns dem Monatsspruch auf einem kleinen Umweg. Rabbi Hillel der Alte, der der Überlieferung nach eine Generation vor Jesus lebte, lehrte: „Sei von den Jüngern Aarons, Frieden liebend und dem Frieden nachjagend.“ Dass Aaron, der Ahnherr des Priesteradels, Jünger oder Schüler hatte, steht gar nicht in der Bibel, und es gibt eigentlich auch keine biblische Geschichte, in der er als Friedensstifter auftritt. Hillel will, so scheint mir, vielmehr sagen: Es kommt nicht darauf an, von vornehmer Abstammung zu sein, sondern: wer friedfertig ist, der ist von wahrhaft edler Art, so edel wie Aaron. In Hillels Ausspruch steckt ferner eine Anspielung auf Ps. 34,15: „Suche Frieden und jage ihm nach.“ Das Psalmwort wird auch im Neuen Testament zweimal zitiert, nämlich im Hebräerbrief (12,14) und im Ersten Petrusbrief (3,11). Auffällig ist, dass der Friede hier als etwas Flüchtiges beschrieben wird, das zu entwischen droht, wenn man ihm nicht aktiv hinterherläuft.
Ähnliche Gedankengänge finden sich in der Bergpredigt Jesu. In den Seligpreisungen heißt es (Mt 5,9): „Selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.“ Wieder geht es darum, dass Friede etwas ist, das aktives Handeln erfordert, das nicht durch passives Aussitzen erreicht wird. „Söhne Gottes“ ist noch weitaus kühner als die Formulierung „Jünger Aarons“, die Hillel gebraucht hatte. Von wem aber werden die Friedensstifter „Söhne Gottes“ genannt werden? Anscheinend von Gott selbst, denn Jesus verwendet nach der Sitte seiner Zeit häufig das Passiv, wenn er von Gott als dem Handelnden spricht. Warum aber „Söhne“ und nicht auch „Töchter“? Auch die Frauen sind gemeint. Wieder ist es die Ausdrucksweise der Zeit. Damals sprach man von einer Gruppe von Menschen, zu der sowohl Frauen als auch Männer gehören, im Maskulinum Plural, und so haben wir es ja auch im Deutschen bislang meist getan. Die Lutherbibel 2017 will es besser machen und übersetzt inklusiv „Kinder Gottes“.
Aber das könnte zu falschen Assoziationen führen. Es gibt fromme Erwachsene, die meinen, als Christin oder Christ dürfe oder solle man wieder so einfältig werden wie ein kleines Kind. Das wäre manchmal ja auch ganz bequem, denn ein Kind trägt keine Verantwortung für sein Handeln. Das ist aber im Text nicht gemeint. Es geht hier nicht um kleine Kinder, sondern um erwachsene Söhne und Töchter. „Söhne“ ist so zu verstehen, dass diejenigen, die Frieden tun, mit ihrem Handeln dem Wesen, der Art Gottes entsprechen, dass sie Anteil an Gott haben. Entsprechend redet unser Herr von „Söhnen des Königreichs“ (Mt 8,12), „Söhnen der Auferstehung“ (Mt 20,36), „Söhnen des Friedens“ (Lk 10,6) und „Söhnen des Lichts“ (Lk 16,8). Es geht bei dieser Redeweise also nicht um eine emotional aufgeladene Vater-Kind-Beziehung, sondern um Anteil an, oder Entsprechung mit, einer Eigenschaft oder Wesensart.
Das Friedenshandeln, zu dem Jesus seine Schülerinnen und Schüler anleitet, hat seine Begründung im Wesen Gottes und nicht in der strategischen Aussicht auf Erfolg. Dieser mag sich zwar zuweilen einstellen, etwa in einfachen Alltagskonflikten, wenn wir boshaftes Verhalten nicht mit gleicher Münze heimzahlen und dadurch unser Gegenüber entwaffnen. Aber in dem Abschnitt, in dem unser Monatsspruch steht, werden Situationen geschildert, die schon aus dem Ruder laufen: Da erleidet jemand grobes Unrecht und will immer noch den Frieden, lässt sich nicht verleiten zu Hass und Rache, obwohl das nach menschlichen Maßstäben völlig gerechtfertigt wäre.
Wie gesagt, es gibt wohl keine einfache Antwort auf die Frage, wie wieder Friede werden kann angesichts der gegenwärtigen militärischen Konflikte. Für heute mag es genügen, dass wir mit der Sehnsucht nach einem Leben gemäß dem Wesen Gottes in den Alltag gehen, denn „Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“ (1Joh 4,16).
Prof. Dr. Dr. Martin Rothkegel
Leiter der Bibliothek und Professor für Kirchengeschichte
Juni 2023
Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle.
(Genesis 27,28 (L))
„Bist Du glücklich?“ Wann hat Ihnen jemand das letzte Mal diese Frage gestellt? Ich meine nicht die eher beiläufige, häufig floskelhafte Frage „wie geht’s?“, sondern die unvoreingenommene, ganz offene, ehrliche und interessierte Frage nach Ihrem persönlichen Wohlergehen. Würden Sie von sich sagen, dass Sie glücklich sind? Finden Sie diese Frage eher leicht oder schwer zu beantworten? Falls Sie zögern – an welcher Stelle spüren Sie den inneren Widerstand? Was gehört für Sie unbedingt dazu, um sagen zu können: „Ja, ich bin glücklich!?“
Ich vermute, die Frage nach dem Glück war im alten Israel auch keine alltägliche. Die Bibel schildert, wie in besonderen Lebenssituationen Menschen einander den Segen Gottes zugesprochen haben. Dann war man nicht geizig mit Wünschen, sondern hat quasi alle Register gezogen. Das zeigt der aktuelle Monatsspruch, ein Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Jakob und seinem Vater Isaak. Isaak segnet seinen Sohn (den er an dieser Stelle noch für den erstgeborenen Esau hält) mit dem Besten, was man sich zu damaliger Zeit nur vorstellen konnte: mit dem „Tau“ des Himmels – obwohl Regen selten verlässlich fiel –, dem „Fett“ der Erde – auch wenn der Acker meist nur mühsam seinen Ertrag lieferte –, mit „Korn und Wein“ die Fülle – obwohl der Hunger ein ständiger Begleiter war. Gewünscht wird kein Durchschnitt, kein „Mehr-oder-weniger-gut-durchkommen“, sondern die ganze Lebensfülle. Was würden Sie sagen, wenn man Ihnen so viel Gutes wünschen würde?
Wenn Sie mögen, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben, darüber würde ich mich sehr freuen – und ehrlich antworten. Versprochen! Sie können Ihre Gedanken natürlich selbstverständlich einfach für sich behalten. Oder sich mit einem guten Freund, einer guten Freundin darüber austauschen. Ich wünsche Ihnen das Beste!
Prof. Dr. Dirk Sager
Professor für Altes Testament
Mai 2023
„Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag.“ (Spr. 3,27)
Der Monatsspruch enthält eine Mahnung, die es in die biblische Sammlung der Sprüche, also der Lebensweisheiten Israels geschafft hat. Eine Ermahnung zur Gebefreudigkeit, die im folgenden Vers noch um die Aufforderung erweitert wird, diejenigen, die um Hilfe bitten, nicht auf den nächsten Tag zu vertrösten, wenn eine direkte Unterstützung möglich ist.
Natürlich hat dieser Bibelvers die harte antike Lebenswirklichkeit vor Augen. Wer seinen Lebensunterhalt nicht durch Arbeit verdienen konnte, der war auf mildtätige Hilfe angewiesen. Es gab weder eine Renten- noch eine Kranken- noch eine Arbeitslosenversicherung. Allenfalls die eigene Familie war zu Unterstützung verpflichtet, aber wenn auch die ausfiel, dann war das Betteln die einzige Möglichkeit zum Überleben.
Aus diesem Grund sind im Alten Testament die Witwen und Waisen sowie die Fremden, die keine Familien haben, die typischen Vertreter der Armut. Der Gott Israels aber erweist sich immer wieder als der Vater und Anwalt dieser Witwen und Waisen (z.B. Psalm 68,6) und als Beschützer der Fremden (z.B. Lev 19,33f). Er hat es seinem Volk zur Aufgabe gemacht, die Rechte der Ärmsten in der Gesellschaft zu schützen und sie mit dem zu versorgen, was sie zum Leben brauchen. Und daher waren Hartherzigkeit und die Weigerung zu helfen ein Widerspruch zu jeder echten Frömmigkeit.
Heute haben alle von Armut betroffenen Gruppen im Sozialstaat einen Rechtsanspruch auf elementare Versorgung durch die Gemeinschaft der Steuerzahler. Und manche leiten daraus ab, sie hätten durch ihre Sozialversicherungsbeiträge und Steuerzahlungen ihre Pflicht zur Hilfe bereits erfüllt. Der Monatsspruch aber fragt nicht danach, wieviel schon gegeben wurde, sondern danach, was die Hand noch vermag. Wieviel ist noch im Portemonnaie? Welche Kraft ist noch da? Wieviel Zeit ist noch frei? Welche Kompetenzen habe ich? Das ist entscheidend.
Wie damals kann auch heute die Gemeinschaft nicht alle Lebensrisiken abdecken. Alleinerziehende mit Kindern sind z.B. in Deutschland die am stärksten von Armut betroffene Gruppe und das wirkt sich auf die Zukunfts- und Gesundheitschancen dieser Kinder extrem negativ aus. Welche finanzielle Unterstützung können wir ermöglichen, welche Zeit ihnen widmen, um sie zu entlasten? Welche Konzepte wechselseitiger Unterstützung können wir entwickeln und welchen politischen Druck aufbauen, damit sie mehr Rechte und eine bessere Versorgung erhalten?
Oder wir nehmen die Not der Geflüchteten, die Überforderung junger Familien, die fehlende therapeutische Versorgung psychisch Erkrankter, die Opfer von sexualisierter Gewalt oder die alleingelassenen Alten. Die Not der Einzelnen kann auch in einer reichen Gesellschaft groß sein, und dann braucht es diejenigen, die sich mit dem, was sie haben, dem, was sie wissen, oder dem, was sie organisieren können, aktiv werden.
Niemand kann alle Nöte dieser Welt beheben. Aber wenn alle Bürgerinnen und Bürger an den Stellen, an denen ihnen ein konkreter Hilfebedarf persönlich im Leben begegnet, ihre Hände nicht verschließen, dann wird diese Welt eine bessere Welt sein. Wenn wir an der einen Stelle, an der wir besonders kompetent sind, an der einen Stelle, an der unsere Hand etwas vermag, uns einsetzen, dann handeln wir im Sinne des Gottes, der uns unser Geld, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Einfühlungsvermögen und unser Wissen vor allem deshalb gegeben hat, damit wir damit Gutes für die Bedürftigen bewirken können.
Prof. Dr. Ralf Dziewas
Professor für Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie
April 2023
Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. (Röm 14,9)
Diese bedeutungsschwere Aussage des Apostels Paulus hat einen erstaunlich alltäglichen Anlass: Streit und Spaltung in der römischen Gemeinde. Der Zusammenhang des Verses zeichnet ein deutliches Bild: In der römischen Gemeinde sieht man die Dinge unterschiedlich. Die einen haben ein weiteres Gewissen, was das Essen von bestimmten Speisen angeht; die anderen ein engeres. Und das ist so ein großes Problem, dass der Apostel mit seinem berühmten Brief darauf eingehen muss. Es ist beruhigend und beunruhigend zugleich, dass schon die ersten Christenmenschen mit Spaltungen und Streitereien gelebt haben. Sicher, die Themen haben sich verändert: Speisevorschriften stehen heute nicht mehr so im Mittelpunkt (wobei die Frage nach dem Fleisch-Essen gerade wieder in neuer Form auflebt), aber die Fragen nach Musikstil, Gemeindeausrichtung und – spätestens seit den Corona-Maßnahmen – auch gesellschaftlich-politische Überzeugungen führen immer wieder neu zu Trennung und Gruppenbildung in der christlichen Gemeinde.
In diese Situation spricht Paulus eine tiefgreifende Wahrheit des christlichen Glaubens hinein; viel tiefgreifender als die Problemlage in Rom, und doch mit Relevanz für die Alltagsprobleme der Gemeinde: Der gestorbene und wieder lebendig gewordene Herr ist der Herr über die Lebenden und Toten, also über zwei Gruppen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dagegen sind die Unterschiede innerhalb der römischen Gemeinde ein Leichtgewicht. Denn Lebende und Tote trennt mehr als nur eine Meinungsverschiedenheit über Speisevorschriften und andere trennende Ansichten. Sie trennt die scheinbar unüberbrückbare Grenze zwischen Leben und Tod! Aber selbst diese scheinbar unüberbrückbare Grenze kann Jesus Christus nicht aufhalten, auch diese Gruppen zu vereinen, indem er ihr einer Herr ist. Also, liebe Gemeinde in Rom, können auch die Grenzen zwischen euch Jesus Christus nicht daran hindern, euer einer Herr zu sein, in allem Streit und aller Spaltung! Derjenige, der durch sein Sterben am Kreuz und durch sein Auferstehen am Ostermorgen die Extreme des menschlichen Daseins in seiner Herrschaft vereint, Leben und Tod, der vereint unter seiner Herrschaft auch die Extreme eurer Ansichten, Meinungen und Spaltungen. Der evangelische Theologe Otto Michel (1903-1993) bringt es in seinem Römerbriefkommentar auf den Punkt: „Der Herr der Toten und der Lebenden vermag auch Herr über die verschiedenen Gruppen in der römischen Gemeinde zu sein.“
Diese Botschaft bewegt mich in Zeiten, in denen Spaltungen innerhalb und außerhalb der christlichen Gemeinde sehr präsent sind (ob es wirklich mehr Spaltungen als in anderen Zeiten sind, darüber habe ich meine Zweifel). Und gewiss wird es uns nicht vollends gelingen, Spaltungen und unterschiedliche Ansichten aufzulösen. Da bleibt es umso wichtiger, gemeinsam immer wieder den Blick auf den zu richten, der uns über alle Grenzen und Spaltungen und unterschiedlichen Ansichten hinweg unter seiner Herrschaft vereint: den gestorbenen und wieder lebendig gewordenen Jesus Christus.
Prof. Dr. Maximilian Zimmermann
Professor für Systematische Theologie an der Theologischen Hochschule Elstal
März 2023
Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? (Röm 8,35)
Der Apostel Paulus formuliert in diesem Satz zwei Fragen. Aber eine Antwort gibt er nicht. Wer die Bibelstelle kennt, weiß, dass die Antwort im Kontext des Verses gegeben wird. Aber die Fragen haben es in sich. Deswegen lohnt es sich, dass wir zunächst die Spannung aushalten, bevor wir uns die Antwort sagen lassen.
Es sind Fragen, in denen sich ein existentielles Ringen ausspricht. Das Ringen um die Gewissheit, ob Gott in notvollen und entbehrungsreichen Lebenssituationen noch unverbrüchlich an unserer Seite steht. Sind wir noch in seiner Hand? Oder erweisen sich die biblischen Zusagen der Treue Gottes nicht doch als warme fromme Worte. Das sind sehr ernste Fragen. Nicht Wenige stellen sie sich.
Ich denke z. B. an Menschen in der Ukraine, die zwischen zerbombten Häusern am eigenen Leib eine unselige Mischung von alldem erleben, was Paulus beschreibt: die Kälte des Winters; Schikane durch marodierende russische Soldaten; die ständige Gefahr, dass die Bombardierung wieder losgehen kann. Ich denke an Menschen, die angesichts seelischer Bedrängnis nicht ein und aus wissen; an solche, die unter bedrohlichen Krankheiten leiden; an Christen, die in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie offen ihren Glauben bekennen. Sind diese Erfahrungen vielleicht doch stärker als Gott?
In solchen Situation genügt es nicht, einfach nur „Nein, sind sie nicht“ zu sagen. Es braucht schon ein bisschen mehr, um Zuversicht zu gewinnen.
Lassen wir uns die Antwort die Paulus gibt, neu zusprechen: Gott ist für uns (V. 31). Er ist so für uns, dass er alles für uns gibt. Nämlich einen Teil von sich. Seinen Sohn Jesus Christus. Er geht für uns in die tiefste Not des Leidens, um dort ein göttliches Netz zu spannen, das uns auffängt; um eine unsichtbare Verbindung zwischen ihm und uns herzustellen, die stabiler ist als alle Anfechtungen und Zumutungen dieser Welt. Dieser Weg Jesu ist Ausdruck einer Liebe, die sich voll und ganz hingibt. Er ist das Siegel, dass Gott endgültig und unverbrüchlich zu uns steht. Von nun an hat er einen letzten Anspruch auf unser Leben und sonst keine Macht der Welt. Nichts Geschaffenes ist stärker als der Schöpfer, die tragende Kraft, die uns unserem Ziel entgegen führt. Auf diesem Hintergrund erklingt am Ende des Kapitel eine ergreifende Gewissheit, von der wir in diesem neuen Monat tragen lassen können: „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“
Prof. Dr. Oliver Pilnei Professor für Praktische Theologie
Februar 2023
Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen. Gen 21,6
An Fasching und Karneval wird viel gelacht. Es ist lustig, sich zu verkleiden und mal ganz anders zu sein, als es der strenge Alltag erfordert. Es ist schön, in andere Rollen zu schlüpfen, und es tut gut, herzhaft über alles Mögliche zu lachen. Ja, dass wir lachen, ist wichtig für unsere körperliche und seelische Gesundheit. Aber noch wunderbarer ist unser Lachen, wenn wir etwas Befreiendes erlebt haben. Das ist das Lachen Saras nach der Geburt ihres Sohnes Isaak.
Endlich konnte Sara befreit auflachen. Die unglaubliche Verheißung, dass sie in ihrem hohen Alter noch einen Sohn gebärt, hat sich erfüllt. Und alle sind gesund: Der Sohn Isaak wird die Verheißung Gottes weitertragen in die Zukunft. Das ist ein ganz anderes Lachen als das verzweifelte und zynische Lachen ein Jahr vorher, als ihr zugesagt wurde, dass sie einen Sohn haben wird (Gen 18,12); ähnlich das verzagte Lachen Abrahams, als er die Verheißung des Sohnes aufnimmt (Gen 17,17). Es gelingt ihnen nicht, die Verheißung Gottes mit ihrer tragischen Lebenssituation zusammenzubringen: Sie sind alt und kinderlos und haben von daher keine Zukunft. Sie versuchen es noch mit ihrer Magd Hagar, die für Abraham ein Kind zur Welt bringt. Wenn man Gottes Verheißung ein wenig nachhilft, dann klappt es vielleicht. Aber das war es nicht, was Gott wollte. Schließlich bekommt Sara selbst ihren Sohn und nennt ihn „Isaak“: „er lacht“, weil sie nach seiner Geburt so befreit lachen kann.
Es gibt viele Arten des Lachens. Doch das befreite Lachen ist Gottes Lieblingslachen, das eben nicht auf Kosten anderer Menschen oder unserer selbst geht, sondern einfach die Freiheit und das Leben feiert. Letztlich wird sich Gottes Verheißung bewahrheiten. Seine Liebe und sein Frieden werden sich durchsetzen. Jetzt müssen wir noch Geduld haben, Gottes Evangelium hören und aufnehmen. Jetzt hinken unsere Erfahrungen noch der Verheißung hinterher; aber die Zeit kommt, da Gott alles erfüllt, das Dunkle verschwinden muss und alles nur noch Freude ist und Lachen. So schön, wenn dieses Lachen schon jetzt immer wieder mal in unserem Leben durchbricht.
Prof. Dr. Michael Kißkalt
Januar 2023
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. (Gen 1,31)
Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres – das Jahr 2023. Vor uns liegen noch unbeschriebene Monate, hinter uns das Neujahrsfest. Vielleicht auch dieses Jahr mit neuen Vorsätzen und neuen Hoffnungen: Wird jetzt alles besser?
„Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.“ Sehr gut?! In den Nachrichten über die Ereignisse in unserer Welt sehe ich oftmals etwas anderes. Da möchte ich manchmal schreien oder auch weinen, aus Verzweiflung und Hilfslosigkeit. Und auch in meinem kleinen Alltag spüre ich Chaos, Ängste oder auch körperliche und seelische Schmerzen. Ist alles so, wie es ist „sehr gut“? Das bezweifle ich. Aber ich bin dankbar, trotz der vielen erschütternden Ereignisse dennoch Freude und Liebe erleben zu dürfen – diese kleinen und großen Lichtblicke, diese „sehr guten Momente“.
Der Schöpfungsbericht in Genesis 1 erzählt davon, wie Gott aus dem lebensfeindlichen Chaos, dem anfänglichen „Tohuwabohu“, ein geordnetes Ganzes erschafft. Seine Freude und Liebe an seiner Schöpfung wird dabei besonders deutlich: Nach jedem Schöpfungstag schaut er sich sein Werk an und bezeichnet es als gut. In Genesis 1,31 schaut er sich seine Schöpfung im Gesamten an – er sieht sie und betitelt sie als „sehr gut“. Er schafft Himmel und Meer, Tag und Nacht, Pflanzen und Tiere und den Menschen, als sein Ebenbild. Und er sieht jeden einzelnen Aspekt seiner Schöpfung und nennt es sehr gut. Gesundes Wachstum geschieht, wenn wir Dinge mit Liebe ansehen und behandeln. In der Schöpfung gibt Gott uns seinen Zuspruch und seine Annahme. Er hat uns aus Liebe erschaffen, er kennt uns und er sieht uns. Auch wenn die Situation heute nicht diesen „sehr guten Zustand“ in der Schöpfungsgeschichte widerspiegelt und so viele Fragen offenbleiben, so kann uns dieser Vers als Erinnerung dienen: Gott ist immer noch unser Schöpfer. Er sieht uns mit Liebe an, bei ihm sind wir angenommen. Und vielleicht können auch wir dadurch unseren Blick wenden und uns auf die Liebe und das Gute in der Welt und in unserem Leben ausrichten. Vielleicht können die Menschen und die Umwelt, die uns anvertraut sind, sich auch unter unserem liebenden Blick gesund entfalten. Vielleicht dürfen wir die Momente, in denen wir die Schönheit und Liebe Gottes zu seiner Schöpfung spüren, noch bewusster wahrnehmen und benennen: Siehe, es war sehr gut.
Natürlich geht es nicht darum, so zu tun, als würde es das Leid und die Ungerechtigkeit nicht geben. Wir dürfen in unserer Ganzheit vor Gott kommen, auch mit dem, was weh tut. Wir dürfen klagen. Ich glaube, dass auch Gottes Herz über die Missstände dieser Welt, seiner Schöpfung, zerbricht. Vielleicht kann uns aber die Erinnerung und Zurückbesinnung auf diesen Ursprung, dem „sehr gut“ in der Schöpfungsgeschichte, neu Kraft und Sicherheit geben: Wir wurden in Liebe angesehen und dürfen so andere in Liebe ansehen. Lasst uns in diesem Sinne das Gute sehen und benennen und es auf diese Weise wachsen lassen.
Dana Sophie Jansen
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Theologischen Hochschule Elstal
Jahreslosung 2023
„Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. Mose 16,13)
„Du bist ein Gott, der mich sieht“. Eine kraftvolle Jahreslosung, die gut für sich selbst stehen kann. Mit diesem starken Titel benennt eine ägyptische Sklavin den Gott Israels. So ist unser Gott, das ist bis heute sein Wesen: Ein Gott, der mich, der dich sieht. Was für eine wunderbare Zusage, die uns 2023 begleitet!
Und doch: Manchmal lösen gerade solche positiven Aussagen Fragen aus. Siehst du auch mich, Gott? Ich habe nicht den Eindruck. Redest du mit mir? Ich höre so wenig. Ermutigung und Enttäuschung liegen manchmal nah beieinander.
Für mich wird dieser fast zu schöne Satz krisenfester, wenn ich ihn in seinem Kontext lese: Als Höhepunkt einer Geschichte, die in knappen Worten viel Schmerzhaftes erzählt. Viel Leid, das erduldet und einander angetan wird. Da ist eine Frau, die jahrelang auf Kinder gehofft hat und jetzt resigniert sagt: Gott hat mir verwehrt, zu gebären. Die ihrem eigenen Mann daher eine Zweitfrau zuführt, ihre Sklavin. Sarai heißt sie da noch, und ihr Mann Abram. Die Sklavin, Hagar, wird nicht nach ihrer Meinung gefragt. Sie wird von Sarai und Abram auch nie mit Namen genannt, immer nur als „meine/deine Sklavin“ bezeichnet. Und als sie, bald schwanger, auf ihre kinderlose Herrin herabsieht, wird sie von Sarai mit Abrams ausdrücklicher Erlaubnis gedemütigt.
In all den großen Themen, unerfüllter Kinderwunsch, Zwangsheirat, Eifersucht, gibt es ein stilleres Leitmotiv, das der Erzähler durch seine Wortwahl hervorhebt: Wie sehen wir einander an – und was lösen wir damit aus? Die Schwangere sieht auf die Kinderlose herab, die Herrin ist plötzlich „wie Nichts“ in den Augen ihrer Sklavin. Sarai ist davon so getroffen, dass sie sich bei Abram die Erlaubnis holt, mit Hagar zu tun, was „gut in ihren Augen ist“. Gut in Sarais Augen ist es, die Sklavin so zu demütigen, dass sie erkennt, wo ihr Platz ist: ganz unten. Die Augen anderer machen mich klein: Diese Erfahrung teilen beide Frauen. Wenn Blicke töten könnten…, sagen wir. Nicht selten erleben wir, wie wahr das Sprichwort ist. Wie schmerzhaft es ist, übersehen zu werden. Wie demütigend es sein kann, wenn meine Schwachstellen ausgeleuchtet werden, mein Versagen, meine wunden Punkte. Kein Wunder, dass die meisten Menschen beides kennen: Den großen Wunsch, gesehen zu werden – und die Angst davor.
Hagar flieht aus dieser Situation in die Wüste. Dort wird ihr ein anderer Blick zuteil. Ein Bote Gottes findet die entlaufene Sklavin. Er spricht sie mit ihrem Namen an, spricht ihr zwei große Verheißungen Gottes zu – mitsamt der Zusage, dass Gott ihre Not gehört hat. Hagars stammelnde Reaktion: „Und sie nannte den Namen des HERRN, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss hab ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat.“
Wieviel Hagar von Gott gesehen hat – wie deutlich sie seinen Blick gespürt hat? Das bleibt wunderbar vage. Zum einen begegnet Gott ihr in Gestalt eines Boten. Erst im Nachhinein erkennt sie in dessen Reden die Worte Gottes. Und dann diese spannende Formulierung am Ende: Die ganze Begegnung erscheint Hagar als „Hinterhersehen“ hinter dem Gott, der sie ansieht. (Ganz wie Mose in 2. Mose 33,18-23 nur hinter Gott hersehen darf.) Die alte griechische Übersetzung bewahrt allerdings eine andere Variante, hier erklärt Hagar mutiger: „ich habe das Angesicht dessen gesehen, der mich sieht.“ Ich mag diesen Nebel über der Szene. So einfach ist das nicht, Gottes Blick wahrzunehmen, seine Stimme zu hören. Er zeigt sich uns – und entzieht sich doch auch. Er geht uns nach auf vielfältige Weisen – aber wir erahnen sein Handeln, seinen Blick auf uns meist nur.
Hagars geheimnisvolle Gotteserfahrung bleibt im Namen des Orts in steter Erinnerung: Brunnen des Lebendigen, der mich sieht (V.14). Und noch viel länger klingt ihr Gotteslob in dieser ergreifenden Erzählung in 1. Mose 16 nach, bis heute. In diesem Jahr sind wir aufgerufen, stammelnd, hoffend, vielleicht auch jubelnd einzustimmen: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Dr. Deborah Storek
Altes Testament
Dezember 2022
Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. (Jes 11,6)
Morgens stehen Sie auf, machen sich vielleicht einen Kaffee, stellen das Radio an und können es nicht fassen. Über Nacht ist Krieg ausgebrochen. Sie sind völlig überrumpelt. Über Nacht sind Menschen, die auch nicht viel anders sind und leben und denken und reden als man selbst, zu tödlichen Feinden geworden. Die Eltern wecken die Kinder, holen sie zum Frühstückstisch. Sie erklären den Kleinen, dass sie sich von nun an vor den Leuten fürchten müssen, die über Nacht Feinde geworden sind. „Aber bei denen sind doch auch Kinder, warum sollen die plötzlich gefährlich sein?“, wundert sich der kleine Junge. Er wird es schnell begreifen. Nach wenigen Tagen wird er gelernt haben, Angst zu haben. Und je älter und vernünftiger die Kinder sind, desto mächtiger wird sich bei ihnen die Angst zu einem zähen Hass gegen die Feinde verdichten. Dass Menschen über Nacht von Frieden auf Krieg umschalten können, vor allem diejenigen, die vernünftig sind und Verantwortung tragen, ist furchtbare Wirklichkeit. Die Logik der Gewalt, der Angst und des Hasses, in die ein Kriegsausbruch die Menschen zwingt, ist eine unheimliche Realität.
Die Vision vom Friedensreich im elften Kapitel des Jesajabuches ist einer der traditionellen Predigttexte zum Weihnachtsfest, an dem die Christen Jesus als den von Jesaja verheißenen Friedensfürsten bekennen. Der Prophet verkündete in Kriegszeiten eine Vision vom Ausbruch des Friedens. „Welch eine Träumerei, in Kriegszeiten Friedensmärchen zu predigen“, denken vernünftige Erwachsene, vor allem die, die Verantwortung tragen, wenn sie die Worte des Propheten lesen: Der Wolf, also der Aggressor, beantragt beim Lamm, also dem Angegriffenen, Asyl. (So steht es im Hebräischen Text: Der Wolf wird sich beim Lamm als „Beisasse“ oder „Proselyt“ niederlassen, also er wird gewissermaßen zum „Lammsein“ übertreten oder konvertieren.) Der Löwe wird grasfressender Vegetarier und wartet morgens bei den Kälbern, damit man ihn auf die Weide führt. Und zwei Verse weiter: Giftschlangen werden zu niedlichen Kuscheltieren. Die Erwachsenen können den Ausbruch des Friedens noch gar nicht fassen. Sie wissen ja, wie gefährlich diese Tiere sind, leidvolle Erfahrung verbietet es ihnen geradezu, den Frieden zu ergreifen. Es sind die Kinder in ihrer ahnungslosen Furchtlosigkeit, die als erste etwas mit dem Frieden anfangen können. Ein kleiner Junge nimmt ein Stöckchen und führt als kleiner Hirte Rind und Raubtier aus dem Dorf auf die Weide. Ein Säugling grabscht mit seinen Händchen nach der Schlange, und es ist Frieden.
Sind wir bereit für den Ausbruch des Friedens? Beim Lesen der Bildrede des Propheten bleiben meine Gedanken an der Erwähnung der Kinder hängen. Im Erdgeschoss des Hauses, in dem ich wohne, ist ein internationaler Kindergarten. Kleine Franzosen und Algerier, kleine Belgier und Kinder aus dem Kongo, drei- und vierjährige Russen und Deutsche buddeln gemeinsam in der Sandkiste und wuseln über den Hof. Von den Kriegen, die ihre Urgroßväter einst gegeneinander geführt haben, von dem Leid und Unrecht, das die einen den anderen angetan haben, wissen sie nichts. Wenn ich die Kinder sehe, muss ich an das Wort unseres Herrn denken, dass wir umkehren und von den Kindern lernen sollen (Mt 18,3). Kein Mensch ist dazu geboren, eines anderen Menschen Feind zu sein.
Prof. Dr. Dr. Martin Rothkegel
Leiter der Bibliothek und Professor für Kirchengeschichte
November 2022
Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen! (Jesaja 5,20)
Eine Erfahrung, die viele kennen: Geschriebene Worte „klingen“ ganz anders, als wenn man direkt miteinander spricht. Per Email oder Handynachricht kommen Worte oft härter, kühler, verletzender an, als sie gemeint waren.
„Wehe…!“ Wie klingt dieses Wort für dich? Ein Gerichtswort, eine Drohung? Die in Jes 5 gesammelten Wehe-Rufe sind auch das. Allerdings leihen sie sich ihr „Wehe“ aus der Totenklage (vgl. 1. Kön 13,30). Neben der Anklage klingt also auch Trauer mit: Klage über einen Weg, der ins Verderben führt.
Der Grundton dieser An-Klagen passt zum leidenschaftlichen Ringen Gottes mit Israel, wie es kurz zuvor im Weinberglied (Jes 5,1-7) beschrieben wurde. Das bittere Resümee in V.7: „Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.“
Ich finde es faszinierend, wie sich bei den Propheten Poesie und Gepolter verbinden. Jesaja hält seinem Volk in Gottes Namen einen herben Spiegel vor, seine Worte sind drastisch – aber auch poetisch-leidenschaftlich. Seine Gerichtsankündigungen sollen die Hörer aufrütteln, sie für Gottes Wege zurückgewinnen.
Die Wehe-Rufe in Jes 5 malen Israels Irrwege aus: Blindes Besitzstreben auf Kosten der Armen (V.8), ausschweifende Feiern (V.11-12.22), Gottvergessenheit und Gotteslästerung (V.12.19). Die schein-sichere Selbstzufriedenheit einer Oberschicht, die nun in politischen Krisen erschüttert wird (V.9.13-15).
Mittendrin richtet unser Monatsspruch den Blick auf Richter, die das Böse nicht aufdecken, sondern unter den Teppich kehren (vgl. auch V.23). Die Ungerechte gerecht sprechen, Gerechte verurteilen. Aber auch Licht und Dunkelheit, sauer und süß werden vertauscht: Eine umfassende Blindheit, ein fader Geschmacksverlust ist zu beklagen. Eine (bewusste?) Verzerrung der Wirklichkeit.
So geht die Anklage weit über die damalige Rechtsprechung hinaus und erreicht auch uns. Auch wir können uns fragen, von Gott zeigen lassen: Wie ist mein Urteilsvermögen? Wie klar sehe ich gesellschaftliche Zusammenhänge; beurteile ich Menschen gerecht? Wo ist mein Blick auf mein eigenes Leben verzerrt? Jesaja ruft auf, Böses offen anzusprechen – aber auch das Gute nicht zu Unrecht zu verurteilen. Das Süße genießen, und das Saure beim Namen nennen. Weder alles schwarzmalen noch das Dunkle schönfärben. Wo erkennst du dich in diesem alten Spiegel? Wer kann dir helfen, dich und andere klarer zu sehen? In diesem November ist nicht Nebel, sondern klare Sicht angesagt.
Dr. Deborah Storek
Altes Testament, Theologische Hochschule Elstal
Oktober 2022
Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Offb 15,3 (E)
Dieses Lied ist nicht von dieser Welt. Gewiss nicht. Wo auch immer die Sänger und Sängerinnen sich aufhalten, – ihr Lobpreis hat wahrhaft himmlische Dimensionen. In wenigen Worten fassen die Liedzeilen zusammen, was in Gottes Reich richtig und gut läuft. Die Taten Gottes werden als „groß und wunderbar“ gepriesen. Die Herrschaft über die ganze Schöpfung liegt in den Händen Gottes. Er regiert über alle Völker und das durchweg „gerecht und zuverlässig“. Weit spannt sich der Bogen von diesem endzeitlichen Lobpreis zurück über die gesamte Menschheitsgeschichte zu den Schöpfungsgeschichten der Genesis. Denn ganz am Anfang hatte Gott bereits sein Urteil über seine Schöpfungstaten gesprochen, „dass es gut war“ und das gleich siebenmal (Gen 1,4.10.12.18.21.25). Das Herrschaftsmandat über die Schöpfung erging damals an den Menschen (Gen 1,28): „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet...“ Aber die von Gott als „gerecht und zuverlässig“ geplanten Wege wurden von den Menschen bald verlassen. Sie wollten selbst „sein wie Gott“ (Gen 3,5). Doch was folgte waren oftmals schlechte Taten der Menschen, herrschsüchtige Ausbeutung und brutale Zerstörung der Schöpfung und Wege voller Ungerechtigkeit, Unzuverlässigkeit und gottloser Herrschaft. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten und die Menschheitsgeschichte auch. So könnten einem viele Strophen eines Klageliedes einfallen, die die irdische Realität mit schrägen Tönen besingen. Doch so hat die Geschichte Gottes mit der Schöpfung und mit seinen Menschen eben nicht angefangen, und so wird sie auch nicht enden! Jene Sänger und Sängerinnen der Johannesoffenbarung proben schon einmal für das große ewige Lobpreiskonzert zur Ehre Gottes. Sie singen ein altes Lied des Mose und erinnern damit daran, wie Gott dereinst in schwerster Zeit die Israeliten aus Ägypten heraus und durch das Schilfmeer hindurch geführt hat (Ex 15). Und sie singen zugleich das Lied des Lammes, das von der Befreiung und der Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz handelt. Dies ist das eine Lied des alten und den neuen Gottesvolkes, das mutig und mit schönsten Tönen Gottes neue Welt herbeisingt: „Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker.“ In diesem Lobpreis wohnt Gott (Ps 22,4) – schon jetzt und mitten unter uns.
Prof. Dr. Carsten Claußen
Professor für Neues Testament an der Theologischen Hochschule Elstal
September 2022
Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. Sirach 1,14
Was ist Weisheit? Wer ist weise und wie zeigt sich das?
Wenn ich mein Lexikon auf „Weisheit“ hin befrage, findet sich da unter anderem „Lebenserfahrung“ – „durch Erfahrung gewonnene Lehre“ - „innere Reife“. Das klingt nach einem langen Weg, an dessen Ende dann „Weisheit“ steht. Wie lange dauert es, weise zu werden? Wächst Weisheit wie ein Baum, langsam, aber beständig? Und irgendwann gibt es dann reife Früchte zu ernten? Oft wird Weisheit gewonnen durch Lebenserfahrung. Manchmal durch Krisen oder durch Fehler und Fehlentscheidungen. Das wirkt sehr anstrengend. Der Monatsspruch weist uns eine andere Möglichkeit, weise zu werden und die klingt ganz einfach. Auf diesem Weg braucht es keine Krisen oder Fehlentscheidungen. Es bedarf nur einer besonderen Haltung bzw. Einstellung: Gott lieben.
Was kann ich tun, wenn ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll? Woher nehme ich die „Weisheit“, eine richtige Entscheidung zu treffen? Mit der Haltung aus Jesus Sirach brauche ich dann nur danach zu fragen, wie ich Gott besser lieben kann. Wie kann ich meine Liebe zu Gott ausdrücken, wenn ich dieses oder wenn ich jenes tue? Welche Entscheidung drückt meine Liebe zu Gott eher aus?
Aber nicht nur, wenn eine besondere Entscheidung ansteht, ist Weisheit gefragt. Weisheit kann unser alltägliches Leben durchziehen. Das betont auch Jesus, wenn er das Dreifachgebot der Liebe als das wichtigste Gebot bestätigt: Du sollst Gott lieben mit allem was Du tust und kannst und bist, mit jeder Faser deiner selbst und deine Mitmenschen sollst du lieben sowie auch dich selbst. Das ist die Grundhaltung in unserem Leben und wenn wir so leben, sind wir auch weise, egal wieviel Lebenserfahrung wir mitbringen. Kinder, junge und alte Menschen können sich in ihrer Liebe zu Gott als „weise Menschen“ erweisen.
Gott lieben, wie geht das? Gott lieben in guten und in schlechten Zeiten: in guten Zeiten durch Dankbarkeit, in schlechten durch Vertrauen. In Zeiten hoher Betriebsamkeit durch Gelassenheit. Wenn andere Menschen in Not sind durch Fürbitte, Beistand und Hilfe. In Warte- und Leerzeiten mit Gebeten und Lobpreis.
Gott lässt sich auf viele Arten lieben: Durch die Liebe zu Menschen, die mir nah sind und durch die Liebe zu Menschen, die mir fremd oder sogar feind sind. Und manchmal liebt Gott auch mich durch diese Menschen und kommt mir so nahe. Vielleicht liegt auch darin Weisheit, dass ich selbst geliebt werde, dass die Liebe zurückkommt auf vielen Wegen und mich liebt, wenn ich unterwegs bin, Gott zu lieben. Die Liebe wächst, indem ich liebe und die Weisheit wächst mit. Wenn ich weise sein will, dann suche ich nach Gelegenheiten, Gott zu lieben und ich bete: Herr, lass mich Dich lieben – zeige mir wie! Und ich suche nach Gelegenheiten, mich von Gott lieben zu lassen.
Was ist Weisheit? Die Antwort auf die Frage ist jetzt leicht: Gott zu lieben, denn Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.
Prof. Dr. Andrea Klimt
Professorin für Praktische Theologie
August 2022
Dann werden jubeln die Bäume des Waldes vor dem HERRN; denn er kommt, die Erde zu richten! (1. Chronik 16,33 E)
In den Osterferien fuhren wir als Familie für ein paar Tage in den Harz. Da wollten wir immer schon mal hin. Es solle sehr schön sein, hatten wir gehört. Wir malten uns die hohen Bäume und das dichte Grün der Nadeln und Blätter aus. Verglichen mit unserer Vorstellung, die wir uns zuvor gemacht hatten, war dann der tatsächliche Anblick eine große Enttäuschung. Der Wald, den wir dort am Aufstieg zum Brocken erblickten, glich eher einer Wüste. Unübersehbare Spuren von Jahren der Dürre. Das trockene Holz bietet dem Borkenkäfer kaum noch Widerstand. Auf halber Höhe abgebrochene Stämme ragen stumm in den Himmel. Ein trauriges Bild, weit entfernt vom Jubel der Natur, der in 1. Chronik 16,33 anklingt. Von diesem Eindruck her fällt es mir schwer, einen mehr oder weniger gezielt ausgesuchten Bibelspruch als zeitlose Wahrheit zu mir sprechen zu lassen. Die Bäume im Harz, würde ich sagen, singen derzeit statt ein Lob- eher ein Klagelied. Und ja, auch in der Bibel hat die Natur Grund zur Trauer: „Heult, ihr Zypressen; denn die Zedern sind gefallen und die Herrlichen vernichtet. Heult, ihr Eichen Baschans; denn der dichte Wald ist umgehauen“ (Sacharja 11,2). Ein förmlich himmelschreiendes Echo der gesellschaftlichen Zustände und des Unfriedens!
Was bleibt dann vom überschwänglichen Jubel der Natur in den Psalmen (Ps 96,12) und bei Jesaja (Jes 44,23; 55,12), aus denen der Chroniktext schöpft? Er behält seine Berechtigung als Intonation unseres Einsatzes für eine friedliebende Welt, die die gesamte Schöpfung einbezieht. Als Ansporn für die Integration von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit. Und er ist für mich ein Ausdruck der Gewissheit, dass Gottes universales Rettungshandeln bereits im Gang ist – auch wenn man es unserer Lebenswelt äußerlich nicht ansehen mag.
Prof. Dr. Dirk Sager
Professor für Altes Testament
Juli 2022
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. (Ps 42,3)
„Wo ist nun dein Gott“ – eine Frage, die dem Beter des Psalms täglich begegnet. Eine Frage, die ihn quält, angesichts seiner Situation, der gefühlten Ausweglosigkeit, angesichts des Schreckens und der Tränen. „Wo ist nun dein Gott“ oder auch „Wo bist du, mein Gott“ – das sind Fragen, die so manch einem Menschen vielleicht nicht so unbekannt vorkommen.
Nicht nur die Seele des Psalmbeters dürstet, meine tut es auch. Der Psalm spricht etwas in meinem Herzen an. Etwas, was sich auch in der Überschrift von Psalm 42 wiederfinden lässt: Sehnsucht. Der Duden beschreibt Sehnsucht als ein „inniges, schmerzliches Verlangen nach jemandem oder etwas“ und auch im Psalm wird deutlich, dass Sehnsucht wehtun kann. Vielleicht ist auch das der Grund, warum ich meine Sehnsucht nicht immer spüren will, warum ich sie oftmals eher „verdrängen“ will. Doch dann lese ich diesen Psalm oder sehe einen atemraubenden Sonnenuntergang oder darf einen Moment tiefster Liebe und Verbundenheit bezeugen und da ist es wieder: Dieser Schmerz, in den schönsten Momenten des Lebens, diese Sehnsucht, die über mich hinausgeht und die immer etwas Unverfügbares mit sich bringt. Oder ich schaue in die Nachrichten, erlebe das Leid um mich herum oder die Dunkelheit in mir drin. Wir können Sehnsucht in den Durststecken unseres Lebens spüren und wir können sie in den vollkommensten Momenten unseres Lebens spüren. Da ist etwas, wovon ich weiß, dass es da ist, dass ich aber noch nicht vollends greifen kann: „Wann werde ich dahinkommen, dass ich Gottes Angesicht schaue“ sagt der Psalmist. Er vergleicht seine schmerzhaft empfundene Sehnsucht im Angesicht der Ungerechtigkeit und des Leids mit dem Lechzen und Schrei eines Hirsches nach frischem Wasser. Durst ist überlebenswichtig und kann unangenehm und sogar tödlich sein, wenn er nicht gestillt wird. Er treibt und lenkt uns und erinnert uns daran, zu trinken. Klares, frisches Quellwasser – ein wundervoller Ausblick im Angesicht des Durstes.
Der Psalm macht mir Mut, den Durst meiner Seele, diese Sehnsucht in mir, wahrzunehmen und genauer hinzuhören: Wonach dürstet meine Seele? Und womit versuche ich, meinen Durst zu stillen? Meine Seele dürstet nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Heilung. Meine Seele dürstet danach, das Wirken des lebendigen Gottes hier in dieser Welt und in meinem kleinen Alltag zu sehen. Meine Sehnsucht treibt mich ins Gebet, hin zu Gott. Mein seelischer Durst verlangt nach dem Lebendigen, nach dem klaren Quellwasser. Der Psalm ermutigt mich, meine Sehnsucht nicht „schön zu reden“, sondern ehrlich zu sein und mit all meinen Emotionen vor Gott zu kommen – auch meine Seele darf schreien, Gott, zu dir.
Dana Sophie Jansen
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Theologische Hochschule Elstal
Juni 2022
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod. Hoheslied 8,6a
Der Vers für den Sommermonat Juni führt uns in das mit Abstand erotischste Buch des Alten Testaments und der ganzen christlichen Bibel: das Hohelied der Liebe, eine Sammlung knisternder Liebesgedichte. Sie zeichnen das Bild einer Liebe zwischen Frau und Mann, die sinnlich und stürmisch, leidenschaftlich und hingebungsvoll, dann wieder zurückhaltend und zärtlich und in all dem rundum beglückend ist. Wer das Buch einmal an einem Stück liest – und das muss man tun, um diesen Vers richtig einzuordnen –, folgt den Liebenden auf Felder und unter Granatapfelbäume; wird Zeuge, wie sich der Mann an der begehrenswerten Schönheit seiner Freundin und die Frau an der imponierenden Gestalt ihres Freundes ergötzt. Wer auch immer diese Texte geschrieben hat: Er oder sie wollte nichts von der Unterscheidung zwischen einer göttlichen Liebe, einer Zuneigung unter Freunden und der erotisch-begehrenden Liebe wissen. Die Verfasserin kannte die Liebe. Eine Kraft, die Zuneigung und Hingabe für einen anderen genauso umfasst wie die unbefangene Freude an der Sexualität. Diese Liebe ist stark wie der Tod, ein schützendes Siegel auf dem Lebensweg. Diese Liebe, die Mann und Frau so wunderbar umfassend vereinigt, ist eine Flamme des Herrn (Vers 6b) – also eine göttliche Kraft. Dadurch wird sie zu einer Erfahrung, in der das menschliche Leben durchsichtig wird für den Einfallsreichtum und die Schönheit des Schöpfers. Deshalb sind diese Texte nicht in einer altorientalischen Gedichtsammlung gelandet, sondern Teil des biblischen Kanons und somit Heilige Schrift geworden. Sie laden uns ein diese Liebe neu zu suchen, zu bewahren, um sie zu ringen, sie zu ehren und zu genießen; in ihr und durch sie dem schöpferischen Grund unseres Lebens ansichtig zu werden; und dem Schöpfer zu danken, dass er uns mit solcher Lebenskraft beschenkt.
Ja, ich weiß, die Liebe ist eine Flamme, die in den Händen von Menschen großen Schaden anrichten kann. Ja, ich weiß ebenfalls, dass es noch ganz anderes über die Liebe zu sagen gibt. Aber das wäre eine andere Andacht.
Deshalb: Nutzen wir doch den Sommermonat Juni, um die im Lied der Lieder beschriebene Liebe zu hegen und zu pflegen und uns an ihr zu freuen.
Prof. Dr. Oliver Pilnei
Professor für Praktische Theologie
Mai 2022
„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht“ (3. Johannesbrief 2)
Von den 27 Einzelschriften des Neuen Testaments sind 21 apostolische Briefe. Aber nur wenige dieser Briefe haben einen so persönlichen, man könnte fast sagen privaten Charakter wie der 3. Johannesbrief. Sein Verfasser nennt sich „der Alte“; das genügte damals, um zu wissen, wer er war. Die kirchliche Überlieferung identifiziert ihn mit Johannes aus dem Zwölferkreis der Jesusjünger. Gerichtet ist sein Brief an einen Gaius, von dem wir sonst nichts wissen.
Dieser apostolische Brief beginnt, wie bis heute viele persönliche Briefe beginnen: Mein Lieber, ich hoffe, dass es Dir gut geht und Du gesund bist! Der apostolische Alte sagt es aber etwas ausführlicher und bringt dabei einen Aspekt ein, der anderswo oft fehlt. Er spricht nämlich von der Seele des Gaius und sagt: Deiner Seele geht es ja gut. Und auch sonst wünsche ich Dir Wohlergehen und Gesundheit.
Der Briefschreiber unterscheidet also Seele und Körper. Die Seele ist das Denken, Fühlen und Wollen des Menschen. Als solche ist sie nicht einfach eine Funktion des Körpers, sondern steht in einer Beziehung zu ihm. Für den apostolischen Briefschreiber beschränkt sich die Seele aber nicht auf ihre Beziehung zum Körper, sondern stellt auch die Beziehung zu Gott her. Wenn also der Alte gewiss ist, dass es der Seele des Gaius wohlergeht, dann meint er die Beziehung des Gaius zu Gott. Diese Beziehung ist intakt, und das erfreut den Schreiber.
Dass unsere Beziehung zu Gott intakt ist, das ist das Wichtigste, weil es über unser ewiges Wohlergehen entscheidet. Aber auch das zeitliche Wohlergehen ist für einen Christen nicht unwichtig. Die Seele lebt ja im Körper, und die kommende Erlösung gilt auch dem Körper. Deshalb wünscht der Apostel dem Gaius, dass es ihm „in jeder Hinsicht“ gut geht und er auch körperlich gesund ist.
Wenn wir als Christen einander „Alles Gute!“ wünschen, dann lasst uns das gemäß dem apostolischen Vorbild sowohl auf das Verhältnis zu Gott als auch auf alle anderen Verhältnisse beziehen, in denen wir leben.
Prof. Dr. Uwe Swarat
Professor für Systematische Theologie an der Theologischen Hochschule Elstal
April 2022
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. (Joh 20,18)
In der Ostererzählung des Johannesevangeliums ist Maria von Magdala die wichtigste Auferstehungszeugin von allen. Zwei Tage zuvor hat sie noch direkt unter dem Kreuz gestanden und miterlebt, wie Jesus vom Kreuz herab dem Jünger, den er besonders liebte, die Verantwortung für seine Mutter übertrug (Joh 19,25-27). So war sie mit zur unmittelbaren Augenzeugin des Todes Jesu geworden. Aber nun ist Maria von Magdala von diesen Personen die Einzige, die sich am Morgen nach der Sabbatruhe in aller Frühe auf den Weg zum Grab macht und entdecken muss, dass das Grab Jesu offensteht.
Sofort läuft sie zu den Jüngern und erzählt ihnen, dass jemand den Leichnam Jesu aus dem Grab weggenommen haben muss. Erst durch ihren Hinweis laufen Petrus und der Jünger, den Jesus liebte, ebenfalls zum Grab und sehen die leeren Leichentücher des Verstorbenen. Doch während die beiden in den Jüngerkreis zurückkehren, bleibt Maria vor Ort und sieht plötzlich zwei Engel im Grab sitzen. Die beiden Engel fragen die weinende Maria nach dem Grund ihrer Trauer und auch ihnen erzählt sie vom gestohlenen Leichnam. Aber bevor die Engel reagieren können, steht plötzlich Jesus selbst hinter Maria und fragt sie: „Frau, warum weinst? Wen suchst du?“
Die folgende Szene entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn Maria nun auch den vor ihr stehenden Jesus selbst fragt, ob er den Leichnam weggetragen habe. Offenbar hält sie ihn in ihrer Trauer für den Friedhofsgärtner. So fixiert ist sie noch auf ihren Verlust, dass sie den Auferstandenen nicht erkennt. Noch kann sie an nichts anderes denken, als an den toten Körper des Verstorbenen, der nicht mehr da ist, wo er sein müsste.
Doch dann ändert sich alles, als Jesus Maria mit ihrem Namen anspricht. In diesem Moment erkennt sie ihn als ihren „Rabbuni“, als ihren Lehrer. Und von diesem Lehrer erhält Maria nun den Auftrag, die Botschaft der Auferstehung zu den Jüngern zu bringen. Dabei soll sie zugleich auch die Ankündigung weitergeben, dass Jesus nun zum Vater hinaufgehen wird. So wird Maria von Magdala zur ersten Botschafterin der Auferstehung und zur Verkünderin der Himmelfahrt Jesu.
Im Zentrum der johanneischen Osterzählung steht somit nicht Petrus, der Anführer des Jüngerkreises. Selbst der im Johannesevangelium ansonsten immer wieder hervorgehobene Jünger, den Jesus besonders liebte, muss hier an die zweite Stelle treten. Die erste Person, die vom Auferstandenen auserwählt wird, ihn direkt zu erleben und die Osterbotschaft zu verkünden, ist die Frau, die bis zu Jesu Tod treu unter dem Kreuz blieb. Es ist diejenige, die am stärksten um den Gekreuzigten trauert und deshalb bereits früh morgens zum Grab geht und als einzige weinend am Grab bleibt, als die Jünger bereits wieder in die Stadt zurückkehren.
Ihre Treue wird mit der Erfahrung des Auferstandenen belohnt und ihre Trauer um seinen Tod durch sein Erscheinen überwunden. Das Erlebnis der Maria von Magdala wird so zur Kernerfahrung der mit ihr beginnenden weltweiten Ausbreitung der Auferstehungshoffnung. Am Anfang des christlichen Glaubens an den Auferstandenen steht das Zeugnis einer trauernden Frau, die nicht aufhört, nach dem Leichnam des Gekreuzigten zu suchen. In dieser Treue wird sie zur ersten Osterzeugin und durch ihre Verkündigung werden dann auch die anderen Jünger darauf vorbereitet, ihre eigenen Erfahrungen mit dem Auferstandenen zu machen, um diese dann in alle Welt hinauszutragen.
Prof. Dr. Ralf DziewasProfessor für Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie an der Theologischen Hochschule Elstal
März 2022
Hört nicht auf zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen (Eph 6,18 [E])
Als Christ könnte man auf diese apostolische Anordnung nur Ja und Amen sagen: „Ja, Beten ist ganz wichtig!“ Andererseits haben wir auch verwirrende Erfahrungen mit dem Gebet, insbesondere mit dem fürbittenden Gebet, gemacht: Manche Bitten finden Antwort und erfüllen sich, andere nicht. Warum erhört Gott manche Gebete nicht? Welchen Sinn hat das Beten überhaupt?
Hier ein kleiner Antwortversuch: Im Gebet ist der Unterschied zwischen dem souveränen Gott und uns Menschen nicht aufgehoben. Es gibt keinen Automatismus, als ob unser Bittgebet auf jeden Fall erfüllt würde. Im Gebet steigen wir nicht zu Gott auf, als ob wir durch unser Gebet über Wohl und Wehe entscheiden würden. Als Menschen beten wir und schütten unser Herz vor Gott aus. Gleichzeitig sind wir uns im Beten dessen bewusst, dass nicht wir alles in der Hand haben, sondern der allmächtige, ewige Gott. Bewegt durch das biblische Zeugnis glauben wir, dass Gott nicht unberührt und unbewegt irgendwo weit weg sitzt, sondern sich durch unsere Geschichte und durch unsere Bitten berühren lässt. In Jesus ist er zu uns gekommen, um uns von Schuld zu befreien und uns in Freud und Leid zu begleiten. Im Heiligen Geist ist er uns nah, trägt und führt uns. Indem wir beten und bitten, suchen wir den Geist Gottes in uns und um uns und richten uns auf ihn aus. Darum gehört das Bittgebet zur Grundausrüstung eines jeden Christen: Wir sind uns unserer Begrenztheit bewusst und suchen die liebende Kraft Gottes. Weil wir dadurch mit den schöpferischen und erlösenden Kräften Gottes verbunden sind, und unser Leben dadurch seinen Grund und sein Ziel findet, sollte diese Art von Gebet und Bitte ein Grundton unseres Lebens sein – „jederzeit“, „wachsam“, ausharrend.
Wenn wir in der Fürbitte an unsere Glaubensgeschwister und mit ihnen an unsere Mitmenschen denken und ihre Not vor Gott bringen, sprechen wir ihnen die Lebenskraft Gottes zu, die uns selbst trägt und durchdringt. Weil wir als Menschen in Freud und Leid miteinander verbunden sind, denken wir fürbittend an die Leidenden und werden sicher auch selbst aktiv werden und Solidarität leben.
Prof. Dr. Michael Kißkalt
Rektor und Professor für Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie
Februar 2022
Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. (Epheser 4,26)
Wer eine zu stark geschüttelte Flasche Cola zu schnell und unbedacht öffnet, dem schießt der Inhalt mit Wucht entgegen. Einmal offen, lässt sich der Inhalt kaum noch zurückhalten und ergießt sich über Hemd und Hose.
Wer bei sich oder einem anderen schon mal einen Zornesausbruch erlebt hat, der kennt im übertragenen Sinn die Erfahrung mit der Flasche. Das Gemüt wurde geschüttelt, gereizt und provoziert. Und dann kommt dieser Punk: Mit Macht platzt es aus einem heraus. Das Bittere: Die folgenden Worte oder auch Taten können üblen Schaden hinterlassen.
Der Zorn ist eine Bewegung des Gemüts, die Menschen mit sich reißen kann. Sie holt etwas aus einem Menschen heraus, was ihn geradezu entstellt. Bilder und Zeichnungen von zornerfüllten Personen haben darum oft entstellende Züge. Aufgrund seiner verzerrenden und vernichtenden Wucht taucht der Zorn theologisch an prominenten Stellen auf: Er ist der Ursprung von Kains Brudermord („da packte ihn der Zorn“ Gen 4,5 Basis Bibel). In der katholischen Theologie gehört er zu einer der sieben sogenannten Todsünden, und die Persönlichkeitstypologie des Enneagramms verbucht ihn unter den Wurzelsünden.
Die Alten hatten einen wachen Blick für die Seelenbewegungen des Menschen. Thomas von Aquin (*1225) erkannte: Der Zorn richtet sich eigentlich auf das Gute, Gerechte, Ehrenhafte, das allerdings verbogen und getreten wird. Aber die Leidenschaft, die er entfacht, ist wie eine zu groß geratene Keule, die Verfehlungen und Schaden nach sich zieht.
Um all das wusste auch schon Paulus. Darum schreibt ein Wort der Weisheit nach Ephesus, das wir uns hinter die Ohren schreiben sollten. Es lautet nicht, dass wir nicht zürnen sollen. Wir sind Menschen. Aber unser Zorn soll keine Sünden nach sich ziehen. Es gilt ihn zu kanalisieren, Stück für Stück den Druck entweichen zu lassen. Wer oft zürnt, darf sich fragen, woher das kommt. Und wenn der Zorn uns mal wieder mitreißt, dann möge er vor Anbruch der Dunkelheit verrauchen. Es gilt den Blick zu heben und den Menschen, denen wir zürnten, mit offenem Angesicht zu begegnen. Dann lässt uns die Nacht zur Ruhe kommen und schenkt heilsame Selbsterkenntnis. Und der neu anbrechende Tag bietet Raum für frische, versöhnte Beziehungen.
Prof. Dr. Oliver Pilnei
Professor für Praktische Theologie
Januar 2022
Jesus Christus spricht: Kommt und seht!
(Joh 1,39 )
„Komm her, und sieh es dir an!“ So ein Satz weckt Neugier, wahrscheinlich auch bestimmte Erwartungen. Was gibt es dort zu sehen? Was ist so besonders, dass es mit den eigenen Augen angeschaut werden soll?
Einige Verse zuvor weist Johannes der Täufer auf Jesus hin. In Vers 36 heißt es „als er Jesus vorübergehen sah, sprach er „Siehe, das ist Gottes Lamm!“ Zwei seiner Jünger hören dies und fangen an, Jesus nachzufolgen. Sie haben auf den Messias gewartet, sie haben ihn erwartet. Welche Gedanken und Emotionen sie wohl hatten, als dieser nun vor ihnen ging und sie seinen Schritten folgten? Welche Erwartungen trugen sie in sich? Als Jesus sie bemerkt, reagiert er etwas anders, als es vielleicht zu erwarten gewesen wäre: „Was sucht ihr?“, fragt er sie.
Was sucht Ihr – was suche ich – in meiner Nachfolge heute? Welche Erwartungen bringe ich mit? Die ersten Jünger haben vielleicht jemanden erwartet, der nach außen hin noch mehr wie ein „König“ aussah. Vielleicht haben sie nicht mit dieser „Einfachheit“ in der Erscheinung Jesu gerechnet. Jesus nimmt sie mit, er lädt sie ein, er beantwortet ihr Suchen: „Kommt her und seht!“. Die Jünger folgen seiner Einladung, sie kommen zu ihm und verbringen den Tag an seiner Seite. Sie sehen ihn, hören ihn und begleiten ihn. Im Anschluss an diesen Tag erzählen sie weiter, dass sie den Messias getroffen haben. Die Begegnung mit Jesus hat Eindruck hinterlassen.
„Kommt und seht“ – eine Einladung Jesu an diejenigen, die ihm nachfolgen und Fragen stellen. Diese Einladung erfordert eine aktive Handlung auf Seiten der Zuhörenden und Suchenden. Sie werden eingeladen, näher zu kommen, sich in Bewegung zu setzen, auf ihn zuzugehen. Sie werden eingeladen, wachsam zu sein und hinzuschauen. Jesus nimmt seine Jünger mit in seinen „Alltag“, die Einfachheit, das normale, echte Leben. Und sie sind berührt – sie haben etwas gesehen und gefühlt, das ihr weiteres Leben verändert. Dafür mussten sie kommen und sehen, es am eigenen Leib erfahren. Nicht Gold oder Silber hat sie zur Nachfolge bewegt, sondern diese menschliche Begegnung mit Jesus. „Kommt und seht“ – vielleicht auch eine persönliche Einladung an mich, mich mitten in meinem Alltag wieder neu einzulassen und von Jesus überraschen zu lassen. Ich bin eingeladen, zu ihm zu kommen.
Dana Sophie Jansen
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Theologische Hochschule Elstal
Jahreslosung 2022
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. (Johannes 6,37)
Abgewiesen zu werden, ist wahrlich keine gute Erfahrung. Man fühlt sich abgelehnt, und das schmerzt. Vor einem Club vom Türsteher keinen Einlass zu bekommen, kann man noch verkraften. Schlimmer ist es, wenn es innerhalb der Familie Abweisung gibt hin und her, weil manche Konflikte nicht gut gelöst werden konnten. Leider findet sich das Ausgestoßen werden auch in der Geschichte und Gegenwart der christlichen Kirche, weil man vermeintlich ethisch nicht angemessen lebt oder seinen Glauben anders formuliert, als es vorgesehen ist. Demgegenüber ist doch unsere Bewegungsrichtung wichtig, dass wir zu Jesus kommen.
Jesus Christus sagt, dass er den nicht abweist, der zu ihm kommt. Interessanterweise gibt er in den Worten zuvor eine tolle Begründung dafür, dass er die Menschen annimmt, die zu ihm kommen: „Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir.“ Er erlebt die Menschen, die zu ihm kommen, als Gabe seines himmlischen Vaters, als Gottesgeschenke. Er bewertet die Menschen nicht nach ihrem Tun oder Denken, sondern er sieht sie mit Gottes Augen – als Gottes Geschöpfe, die ihm anvertraut sind. Darum weist Jesus sie nicht ab.
Jesus nimmt uns an und passt auf uns auf! Das ist zuerst einmal eine wunderbare Botschaft für uns selbst. Mögen wir vielleicht von dem einen oder anderen Menschen abgewiesen werden, bei Jesus, und damit bei Gott, wird uns das nicht passieren. Egal, wie gut oder wie schlecht wir uns fühlen, Jesus nimmt uns an!
In dieser wunderbaren Zusage spüren wir aber auch die Frage an uns, wie wir mit Menschen umgehen, die zu uns kommen, zu mir persönlich oder zu uns in die christliche Gemeinschaft. Welche Voraussetzungen müssen sie erfüllen, um von uns angenommen zu werden? Wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir unsere Herzen und Türen für alle Menschen öffnen – so wie Jesus es tat. Wenn Menschen sich von uns distanzieren, weil sie nicht mit uns zu Jesus kommen wollen, dann steht ihnen das frei. Falsch wird es, wenn Menschen mit uns zu Jesus kommen wollen, wir es ihnen aber nicht erlauben, aus welchen Gründen auch immer. Besser ist es, die Perspektive Jesu einzunehmen: Jeder Mensch, der zu uns kommt, ist ein Gottesgeschenk! Darum sind unsere Türen offen, und wir feiern zusammen Gottes Liebe.
Prof. Dr. Michael Kißkalt
Rektor und Professor für Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie