
Foto: Bernhard Bührke
Glaube und Taufe
Das Leben unter der Gottesherrschaft
Dieser Abschnitt der Rechenschaft vom Glauben gilt mit der Taufe dem Herzstück baptistischen Selbstverständnisses. Immerhin heißen Baptisten (vom griechischen Wort baptizo) auf Deutsch Täufer. Dabei geht es nicht um die Taufe an sich – sie verbindet Baptisten mit fast allen anderen Christen – sondern um den besonderen Zusammenhang von Glauben und Taufe, wie dieser Abschnitt heißt.
Freilich gilt auch hier, dass das baptistische Verständnis der Taufe Teil einer konfessionell geschlossenen Gesamtinterpretation des Evangeliums ist. [1] Dieses Verständnis der Taufe teilen Baptisten mit der Täuferbewegung der Reformationszeit (vgl. das Täufergedenken im Jahr 2025) und mit anderen Gemeindebünden, die aus dieser Bewegung hervorgegangen sind, etwa den Mennoniten, aber auch mit anderen glaubenstaufenden Traditionen wie den Brüdergemeinden (Christusforum). Sie alle betonen, dass Glauben und Taufe ganz eng zusammengehören: Nur Menschen, die das Evangelium gehört, verstanden und angenommen haben, sollen auf ihren Glauben an Jesus Christus hin getauft werden. Diese Reihenfolge entspricht dem Neuen Testament: „Wer da glaubt und getauft wird …“ (Mk 16,16) oder „… die sein Wort annahmen, ließen sich taufen“ (Apg 2,41).
Der erste Absatz dieses Abschnitts fasst wesentliche neutestamentliche Aussagen zu Aneignung des in Jesus Christus geschenkten Heils zusammen. Die Initiative war, ist und bleibt bei Gott. Im Evangelium bietet er seine Gnade an – darauf antworten Menschen und müssen antworten! Gott wirkt Glauben, zugleich werden Menschen zum Glauben aufgerufen. Erst dann haben sie Anteil an Gottes Heilshandeln in Jesus Christus. Sie lassen sich Gottes Urteil gefallen, wenden sich ihm zu und vertrauen auf ihn. Gott beschenkt die Glaubenden mit seinem Heil. Genannt werden hier Vergebung und ewiges Leben. Im NT ist außerdem etwa von Versöhnung, Frieden mit Gott und Erlösung die Rede. Dieses Vertrauen hat Folgen: Christen wenden „sich von allem Bösen ab, bekennen fortan Jesus Christus als ihren Herrn und erklären sich bereit, als Glied der Gemeinde ein verbindliches Leben in der Nachfolge Jesu Christi zu führen“. Ich habe die Formulierungen der RvG in den Plural gesetzt, da es sich um ein kollektives Geschehen handelt … so sehr auch jeder einzelne Mensch aufgefordert ist, im Glaubensgehorsam auf das Evangelium zu antworten.
Der folgende Absatz erklärt, wie sich Glauben und Taufe zueinander verhalten. Die Taufe bezeugt, dass Menschen zum persönlichen Glauben gekommen sind, daher – sachlich richtig – nicht Erwachsenentaufe (das Alter ist nicht entscheidend), sondern Glaubenstaufe. Daher kommt die entsprechende Taufformel: „Aufgrund deines Glaubens an Jesus Christus taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Mt 28,19). Nur Freiwillige werden getauft; wenn auch gut gemeint, soll in der Gemeinde niemand zur Taufe gedrängt werden.
Während das Abendmahl regelmäßig gefeiert wird, werden Menschen nur einmal getauft. Daher lehnen auch Baptisten eine Taufwiederholung im Sinne einer Wiedertaufe ab. Dennoch taufen sie Menschen, die als Säuglinge getauft wurden, weil sie in diesem Akt bestenfalls eine Segenshandlung und Willensbekundung der Eltern, Taufpaten und Gemeinde sehen, aber keine gültige Taufe im Sinn des Neuen Testaments. Daher sind Baptisten keine „Wiedertäufer“, wie man sie oft polemisch bezeichnet hat.
Viel wichtiger als Bezeichnungen ist die letzte Anmerkung: Taufe ist kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt: Der Start in ein neues Leben unter der Herrschaft Gottes.
Der dritte Abschnitt umreißt, was in der Taufe geschieht. Sie ist Bestätigung: zum einen persönliche, leiblich erfahrbare Bestätigung des Zuspruchs des Evangeliums an die Täuflinge durch den Täufer und die anwesende Gemeinde und zum anderen Bekenntnis der zu taufenden Menschen. Treffend wird dieses Bekenntnis in der RvG zusammengefasst:
Jesus Christus ist auch für mich gestorben und auferstanden. Mein altes Leben unter der Herrschaft der Sünde ist begraben, durch Christus ist mir neues Leben geschenkt. Gott gibt mir Anteil an der Wirkung des Todes Jesu Christi. Er lässt auch die Kraft seiner Auferstehung an mir wirksam werden, schon jetzt durch die Gabe des Heiligen Geistes und einst durch die Auferweckung zum ewigen Leben.
Darum werden Taufwillige in der Regel zu einem Gespräch eingeladen und „geprüft“. Haben sie das Evangelium verstanden und angenommen? Haben sie noch Fragen? Oft werden sie zudem aufgefordert, vor ihrer Taufe ihren Glauben vor der Gemeinde zu bekennen, ein „Zeugnis“ zu geben. Wenn auch nicht unbedingt in diesen oder anderen geschliffenen Worten, sollten diese Inhalte und Erkenntnisse im persönlichen Bekenntnis vorkommen, sonst kann eine Glaubenstaufe zur Farce werden.
All dies geschieht in dem Wissen, dass Glaube wächst, sich verändern kann, sich im Alltag bewähren muss und angefochten ist – daher die Gemeinde als Gemeinschaft der Glaubenden. Viele Gemeinden stellen den Getauften Begleiter zu Seite, die ihnen auf dem Weg der Nachfolge helfen und ihnen den Weg in die Gemeinde ebnen.
Taufe ist kein „krönender Abschluss“, sondern führt in die Gemeinschaft der Gemeinde. Darum sollten Taufen auch im Kontext der versammelten Gemeinde stattfinden. Die Zugehörigkeit zu Christus und seinem Leib lässt sich von einer Ortsgemeinde nicht trennen; hier bringen Christen ihre Zeit, ihre Mittel, ihre Begabungen und Geistesgaben ein, um Gottes und der Gemeinde willen! Christen brauchen einander! In der Verbindlichkeit einer Mitgliedschaft und der regelmäßigen Teilnahme am Gemeindeleben erfahren Christen gegenseitige Hilfe, Ermutigung, Trost und Korrektur … das geht digital nur begrenzt oder auf Dauer gar nicht.
Wie in jedem knapp und präzise formulierten Bekenntnistext bleiben auch in diesem Abschnitt einige Fragen zur Theologie und Praxis offen. Etwa ab welchem Alter man davon ausgehen darf, dass Menschen das Evangelium verstehen und glauben können. Ist das nur individuell erkennbar (an welchen Kriterien?) oder hält man sich einfach an das staatlich festgesetzte Alter der Religionsmündigkeit (14 Jahre)?
[1] Vgl. C. H. Ratschow, „Konfession/Konfessionalität“, TRE 19 (1990), (419–426) 419.
Einladung zum Weiterdenken
1. Wie habe ich den engen Zusammenhang zwischen Glauben und Taufe bisher erlebt? Wie war das bei meiner eigenen Taufe? Was ist vom Zuspruch des Evangeliums und dem Bekenntnis des Glaubens noch übrig?
2. Welche Rolle spielt die Taufe in unserer Gemeinde – von einer gelegentlichen Tauffeier abgesehen?
3. Sollten wir Menschen taufen, die aber nicht zu einer Gemeinde gehören wollen?
Erschienen in: Die Gemeinde 13/2022, S. 16-17.
Ein Artikel von Prof. Dr. Christoph Stenschke, Dozent für Neues Testament an der Biblisch-Theologischen Akademie Wiedenest
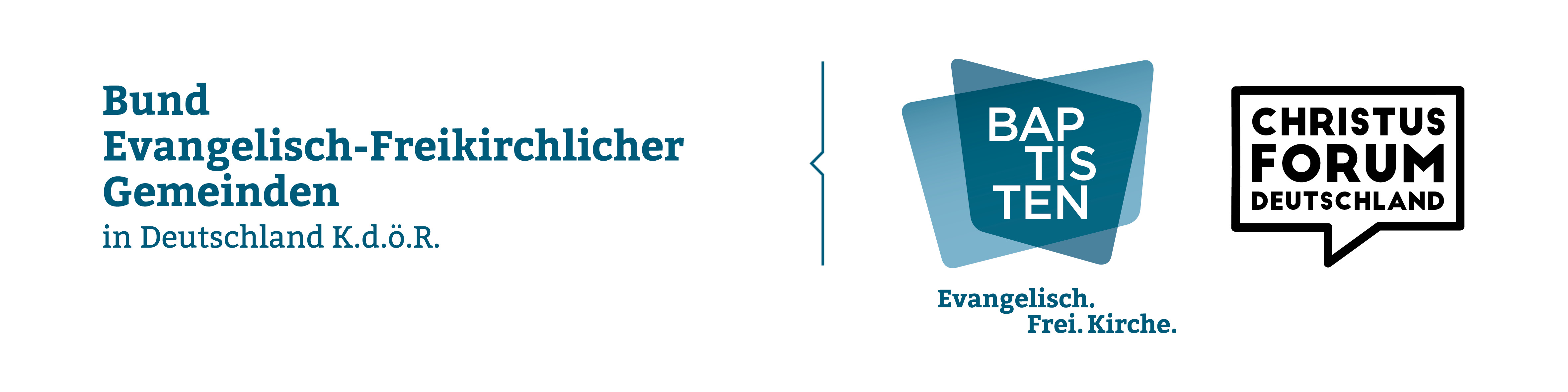

Kommentare (2)
Voigt
am 18.11.2023Volker Warmbt
am 28.09.2022